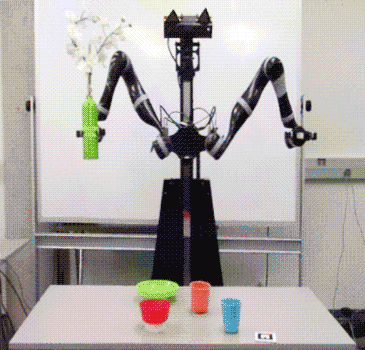Von
Messina aus breitete sich die Pest auf dem ganzen Kontinent aus. Die
Pandemie, die man später den "Schwarzen Tod" nennen sollte, wurde eine
der größten Katastrophen der Geschichte. Vermutlich ist dabei ein
Drittel der Bevölkerung Europas gestorben, mindestens 25 Millionen
Menschen. Einige Länder, etwa Frankreich und Italien, dürften die Hälfte
ihre Einwohner verloren haben. Auslöser der Seuche ist das Bakterium Yersinia pestis;
der sogenannte Rattenfloh überträgt es auf Ratten ebenso wie auf
Menschen. Wer damals an der Pest erkrankte, bekam schwarze Eiterbeulen
und starb oft schon wenige Stunden nach der Ansteckung.
Die
gegenwärtige Corona-Epidemie, der bis Freitag weltweit mehr als 96 000
Menschen zum Opfer gefallen sind, hat ganz sicher auch nicht annähernd
die Dimension der mittelalterlichen Pest. Aber in einem wichtigen Punkt
lohnt sich trotzdem ein Vergleich. Epidemien haben oft langfristige und
überraschende wirtschaftliche Konsequenzen. Die Pest ist dafür ein
besonders gutes Beispiel. Kurzfristig waren die Folgen für Wirtschaft
und Gesellschaft furchtbar. Der Dichter Francesco Petrarca schrieb 1350,
nachdem er die Stadt Rom besuchte: "Die Häuser liegen nieder, die
Mauern fallen, die Tempel stürzen, die Heiligtümer gehen unter, die
Gesetze werden mit Füßen getreten." Anders als der Coronavirus traf die Pest vor allem junge Leute, was den wirtschaftlichen Schaden noch erhöhte.
Langfristig
jedoch führte die Katastrophe paradoxerweise dazu, dass es den
Überlebenden substanziell besser ging und Europas Wirtschaft sich
schneller entwickelte. Im Mittelalter, als es noch keine Industrie gab,
hing das Wohlergehen der Menschen davon ab, wie viel und welches Land
sie für die Landwirtschaft zur Verfügung hatten. Weniger Menschen
bedeuteten mehr und besseres Land - also auch weniger Hunger und höhere
Reallöhne. Der Wirtschaftshistoriker Hans-Joachim Voth von der
Universität Zürich sagt: "Die Pestepidemie ist einer der Auslöser der
Großen Divergenz zwischen Europa und dem Rest der Welt." Unter der
Großen Divergenz verstehen Historiker die Tatsache, dass die europäische
Wirtschaft spätestens nach 1700 sehr viel leistungsfähiger wurde als
die anderer Kulturen wie China und Arabien. Zusammen mit seinem Kollegen
Nico Voigtländer ( Universität Yale) veröffentlichte Voth eine Studie,
die den Zusammenhang beschreibt: Der Bevölkerungsrückgang durch die Pest
war so massiv, dass er auch mit mehr Geburten so schnell nicht
ausgeglichen werden konnte. Deshalb wurde Arbeit knapp und teuer: "Über
ein paar Generationen erlebte der alte Kontinent ein goldenes Zeitalter
der Arbeit," heißt in dem Papier.
25 Millionen Menschen oder mehr
...fielen zwischen 1347 und 1353 der Pest zum Opfer. Das war mindestens ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas. In Frankreich, Italien und anderen Ländern starb sogar die Hälfte der Einwohner. Die Überlebenden allerdings hatten Vorteile von der Entvölkerung des Kontinents. Mehr Land pro Einwohner stand jetzt zur Verfügung, die Menschen hatten mehr zu essen. Die Wohlhabenderen leisteten sich auch mehr Luxuswaren, was die Wirtschaftsentwicklung förderte. Beispielhaft für die Zeit nach der Pest war der Aufstieg der Familie Fugger in der alten Reichsstadt Augsburg.
...fielen zwischen 1347 und 1353 der Pest zum Opfer. Das war mindestens ein Drittel der damaligen Bevölkerung Europas. In Frankreich, Italien und anderen Ländern starb sogar die Hälfte der Einwohner. Die Überlebenden allerdings hatten Vorteile von der Entvölkerung des Kontinents. Mehr Land pro Einwohner stand jetzt zur Verfügung, die Menschen hatten mehr zu essen. Die Wohlhabenderen leisteten sich auch mehr Luxuswaren, was die Wirtschaftsentwicklung förderte. Beispielhaft für die Zeit nach der Pest war der Aufstieg der Familie Fugger in der alten Reichsstadt Augsburg.
Die
höheren Löhne reichten nicht nur fürs Überleben, viele Menschen konnten
sich jetzt auch Luxusprodukte leisten. Die wurden in Städten
hergestellt, weshalb die Verstädterung zunahm, der Geldumlauf und das
Steueraufkommen. Beispielhaft dafür ist der Aufstieg der Fugger. Er
begann kurz nach dem Ende der Pestzeit, als 1367 Hans Fugger, der Sohn
eines Bauern aus Graben im Lechfeld, in die Freie Reichsstadt Augsburg
zog und sich bei einem Leineweber verdingte. Er verwob Flachs mit
feiner, importierter Baumwolle zu luxuriösem Barchent und begründete so
ein Familienimperium, das jahrhundertelang Bestand hatte.
Auch
die Inflation in Europa ging zurück, wie der Historiker Klaus
Schmelzing in einem neuen Arbeitspapier für die Bank von England
schreibt: von 1,58 Prozent jährlich auf nur noch 0,65 Prozent von 1360
bis 1460. Es gab also keine Teuerung mehr, vor der die Menschen hätten
Angst haben müssen. Die Pest hatte auch die Einstellung zum Konsum
verändert. Die traumatische Erfahrung, dass das Leben plötzlich vorbei
sein kann, führte, so Schmelzing, zum Wunsch, dieses wenigstens in
vollen Zügen zu genießen. Das hatte zur Folge, dass der Anteil des
Vermögens, der für den Konsum verwendet wird, zwischen 1350 und 1450
stark gestiegen ist. Ein Indiz dafür sind die Gesetze gegen
übertriebenen Luxus, die viele italienische Städte erlassen haben.
Venedig zum Beispiel verfügte 1430 eine Obergrenze für die Absatzhöhe
von Damenschuhen.
Dieser
Luxuskonsum war, nach Meinung einiger Forscher, die Voraussetzung für
die Renaissance und den Abschied vom Mittelalter. Die höheren Löhne
bedeuteten aber nicht unbedingt, dass es den Menschen in der Zeit gut
ging. Tatsächlich nutzten Fürsten und Könige die höheren
Steueraufkommen, um mehr Kriege zu führen. Die Städte wurden größer,
aber das Leben in diesen Städten war extrem ungesund: Menschen und Tiere
lebten eng beieinander, die Bürger entleerten ihre Nachttöpfe einfach
auf die Straße, und Stadtmauern begrenzten das räumliche Wachstum.
Krieg, Verstädterung und importierte Seuchen begleiteten den Fortschritt
in Europa wie drei "apokalyptische Reiter", schreiben die Forscher Voth
und Voigtländer in Anlehnung an die Offenbarung des Johannes in
der Bibel.
Sowohl vor als auch nach dem Schwarzen
Tod wurde die Menschheit von mörderischen Epidemien heimgesucht. Auch
deren wirtschaftliche und politische Folgen waren unabsehbar. So brach
542 in Konstantinopel die Beulenpest aus. Diese nach dem oströmischen
Kaiser Justinian benannte "Justinianische Pest" verheerte den gesamten
Mittelmeerraum und könnte den Aufstieg des islamischen Weltreichs
hundert Jahre später begünstigt haben.
Eine
besondere Rolle im kollektiven Gedächtnis von Europäern und
Nordamerikanern spielt die Spanische Grippe, die gegen Ende des Ersten
Weltkriegs ausbrach. Von den absoluten Zahlen her war sie schlimmer als
der Schwarze Tod: Mindestens 500 Millionen Menschen - ein Viertel der
damaligen Erdbevölkerung - wurden angesteckt, mehr als 50 Millionen
starben, viel mehr als im Krieg selbst. Die wirtschaftlichen Folgen
waren aber zu vernachlässigen. Nach einer Schätzung des kanadischen
Finanzministeriums kostete die Grippe ganze 0,1 Prozent
Wirtschaftswachstum. Das mag damit zusammenhängen, dass als Folge der
Demobilisierung nach dem Krieg sowieso eine Rezession ausgebrochen war.
Allerdings
entfällt in Industriegesellschaften auch der langfristige
Wachstumseffekt der Entvölkerung, wie er nach der Pestepidemie im
Mittelalter festgestellt wurde. Wenn die meisten Waren in Fabriken
hergestellt werden, wird es für die Reallöhne im Verhältnis weniger
wichtig, wie viel Land für die Produktion von Lebensmitteln zur
Verfügung steht.
Lernen kann man am Beispiel der Spanischen Grippe, wie wichtig Social Distancing in einer Pandemie ist. Nach einem Bericht des Wall Street Journal
wartete die Stadtverwaltung von Philadelphia 16 Tage, bis sie die
Bewegungsfreiheit ihrer Bürger einschränkte. Sogar eine Parade wurde
noch genehmigt. Der Preis war hoch: Auf dem Höhepunkt der Seuche lag die
Sterberate in Philadelphia fünfmal so hoch wie in St. Louis, das nach
zwei Tagen mit Social Distancing begonnen hatte.
Das gab es noch nie: Die ganze Welt riskiert eine Rezession, um die Pandemie zu bekämpfen
Heute
weiß man, dass es während einer Pandemie eine klare Wahl gibt: Entweder
eine Gesellschaft akzeptiert kurzfristig wirtschaftliche Schäden, um
die Seuche einzudämmen. Oder sie bezahlt dafür mit vielen Toten in der
Zukunft. Was die jetzige Pandemie von allen anderen in der bisherigen
Geschichte unterscheidet, ist die Tatsache, dass der größte Teil der
Welt diese ökonomischen Kosten akzeptiert, dass sie eine schwere
Rezession zulässt, um den Kollaps der Gesundheitssysteme zu verhindern
und Menschenleben zu retten. In einigen Ländern, vor allem in Donald
Trumps Amerika, kam die Reaktion verspätet, aber sie kam irgendwann
doch. Gleichzeitig geben Politiker und Notenbanker Billionen Dollar und
Euro aus für Programme, die vor wenigen Wochen noch unvorstellbar waren.
All
dies hat es bisher noch nie gegeben. Auch wenn die Seuche eingedämmt
ist und es einen Impfstoff gibt, wird sich die Politik daher mit den
Spätfolgen der Rettungsprogramme befassen müssen. Über die Einzelheiten
kann man heute nur spekulieren. Droht angesichts des vielen gedruckten
Geldes jetzt wieder Inflation? Wird die Erfahrung mit den
Lieferschwierigkeiten für Atemmasken und Beatmungsgeräte den Wunsch nach
Autarkie in vielen Staaten verstärken? Werden Experimente wie das
bedingungslose Grundeinkommen beliebter? Wird die Europäische Union das
alles aushalten?
Nur eines ist sicher: Nach Corona wird die Welt anders aussehen als zuvor.
Nota. - Doch ob sie nur ein bisschen anders aussehen wird oder sehr viel anders, ist ganz und gar nicht sicher.
JE
Nota. - Doch ob sie nur ein bisschen anders aussehen wird oder sehr viel anders, ist ganz und gar nicht sicher.
JE
Nota. Das
obige Bild gehört mir nicht, ich habe es im Internet gefunden. Wenn Sie
der Eigentümer sind und seine Verwendung an dieser Stelle nicht
wünschen, bitte ich um Nachricht auf diesem Blog. JE