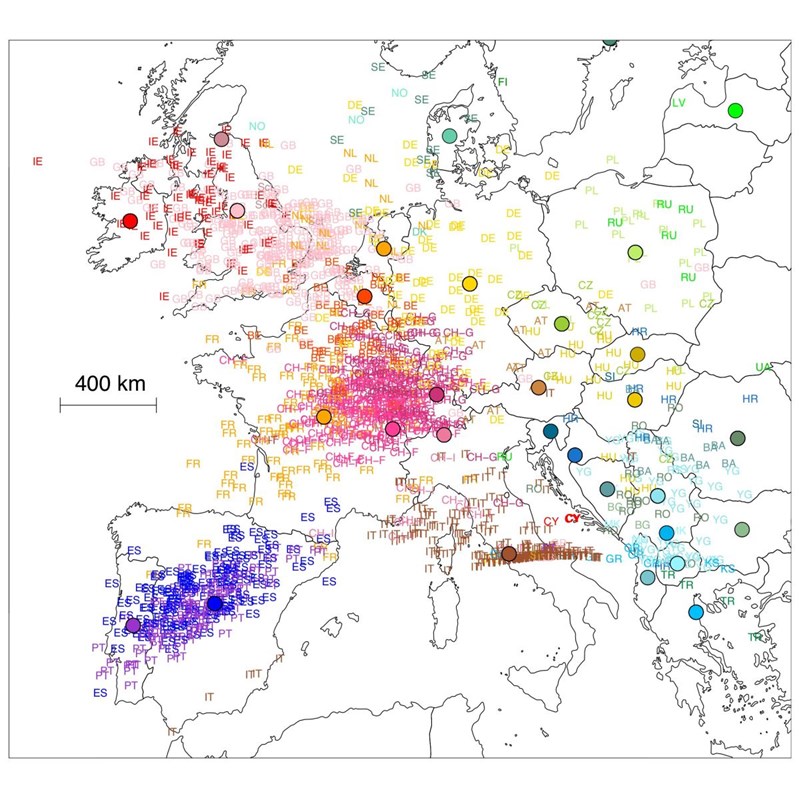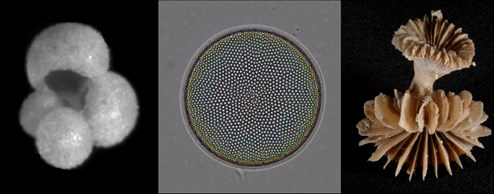aus scinexx Steinkreise und die Grabanlage (links) von Lotham North
Größtes Steinzeit-Monument Ostafrikas entdeckt
5.000 Jahre alte Grabanlage stammt überraschenderweise von nomadischen Hirten
Spektakulärer Fund: In Kenia haben
Archäologen das älteste und größte Steinzeit-Monument Ostafrikas
entdeckt. Es handelt sich um eine rund 5.000 Jahre alte Grabanlage, die
von Megalithsäulen, Stein- pflaster und mehreren Steinkreisen umgeben ist.
Mehr als 580 Menschen wurden hier im Laufe einiger Jahrhunderte
begraben. Ungewöhnlich daran: Die Erbauer dieser Monumente waren
nomadische Hirten mit einer egalitären Gesellschaftsstruktur – das
widerspricht bisherigen Annahmen zu prähistorischen Monumentalbauten.
Schon vor tausenden von Jahren errichteten unsere Vorfahren
monumentale Anlagen, die als Ritualorte, Grabstätten oder astronomische Observatorien dienten. Unter ihnen sind der Steinkreis von Stonehenge in England, aber auch das Steinzeitheiligtum von Göbekli-Tepe in der Türkei, präkolumbianische Anlagen in Peru sowie mehrere Kreisgrabenanalgen in Deutschland, so bei Pömmelte, bei Watenstedt oder Goseck.
Diesen prähistorischen Monumenten ist gemeinsam, dass sie nur unter
enormem Aufwand an Menschen und Material erbaut worden sein können.
Zudem erforderten sie eine gute Planung und Logistik, um die Arbeiten zu
koordinieren. Unter anderem deshalb hielten Forscher bisher nur
komplexe, hierarchisch gegliederte Gesellschaften für fähig, solche
Monumentalbauten zu errichten.
Steinkreise, Plattformen und Hügelgräber
Doch jetzt haben Elisabeth Hildebrand von der Stony Brook University in
New York und ihr Team ein Steinzeitmonument entdeckt, das dem
widerspricht. Es handelt sich um eine insgesamt 1.400 Quadratmeter große
Anlage, die vor rund 5.000 Jahren am Ufer des Turkanasees in Kenia
errichtet worden ist. Sie besteht aus einer 700 Quadratkilometer großen
Steinplattform, an die sich neun Steinkreise und sechs Steinhügel
anschließen.
Die Lothagam North getaufte Anlage ist damit der größte und älteste
Monumentalbau in ganz Ostafrika, wie die Forscher berichten. Sie stammt
aus einer Zeit, als ein Klimawechsel zu trockeneren Bedingungen viele
nomadi- sche Viehzüchter aus dem Saharagebiet vertrieb. Diese
Pastoralisten zogen weiter nach Süden und Osten und kamen so auch an den
Turkanasee. Ähnlich wie schon zuvor in der Sahara, begannen sie auch
dort, rituelle Monumente zu errichten – nun jedoch in größerem Maßstab.
Unter der von Basaltkieseln bedeckten Plattform (vorne) liegt eine Grabanlage mit mindestens 580 Toten.
Aufwändige Grabanlage
Wie Ausgrabungen enthüllten, hat die Plattform von Lothagam North ein
komplexes Innenleben. Sie verrät, welchen enormen Aufwand die Erbauer
betrieben. "Zuerst trugen sie in einem 120 Quadratmeter großen Areal den
Ufersand bis auf den Felsuntergrund ab", berichten Hildebrand und ihre
Kollegen. Die umliegenden Sandbereiche wurden mit einem Pflaster aus
Sandsteinplatten bedeckt und das Ganze mit einem Ring aus säulenartigen
Felsbrocken umgeben.
Das Entscheidende aber lag im Zentrum dieser Steinplattform. Hier
meißelten die steinzeitlichen Erbauer hunderte eng beieinanderliegende
Grabkuhlen in den Felsuntergrund. Im Laufe von mehreren hundert Jahren
wurden hier mindestens 580 Männer, Frauen und Kinder bestattet. Ihr
Alter reichte von Neugeborenen bis zu Alten, wie die Forscher berichten.
Nach der Bestattung wurde das gesamte Gräberfeld mit Geröll zu einem
flachen Hügel aufgefüllt und dieser mit gleichgroßen Basaltkieseln
bedeckt.
Geschmückte Tote
Der Blick in die Gräber enthüllte: Fast alle Skelette trugen
Schmuckstücke. "Viele Individuen hatten Perlen aus Austernschalen oder
Stein um Hals, Hüften oder Knöchel", berichten die Archäologen. "Andere
trugen Ringe oder Armreifen aus Nilpferdelfenbein." Auch Halsschmuck aus
Nilpferdzähnen, geschnitzte Anhänger und andere Schmuckstücke lagen bei
den Toten.
Perlen und Anhänger aus verschiedensdten Mineralen schmückten die Toten.
Hinweise
auf verschiedene Klassen oder soziale Unterschiede fehlten dagegen:
"Dieser Schmuck war nicht auf eine Altersgruppe, ein Geschlecht oder
einen Grabtyp beschränkt", sagen Hildebrand und ihre Kollegen. "Das
spricht dafür, dass diese Verzierungen die Norm waren." Auch in der
Anordnung der Gräber oder der Art der Bestattungen seien keine sozialen
Hierarchien ablesbar. Nach Ansicht der Forscher spricht dies dafür, dass
die Erbauer dieser Anlage in einer eher egalitären Gemeinschaft ohne
Eliten oder Schichten lebten.
Soziale Gleichheit statt Hierarchie
"Damit wiederspricht diese Entdeckung früheren Vorstellungen über
Monumentalität", konstatieren die Wissenschaftler. "Denn Lothagam North
liefert uns ein Beispiel für einen Monumentalbau, der nicht eindeutig
mit der Ausprägung sozialer Hierarchien verknüpft ist." Die Anlage von
Lothagam North war offenbar keine Machtdemonstration einer Elite,
sondern ein Ritual- und Grabplatz für alle.
Noch dazu wurde diese riesige, aufwändige Grabanlage von nomadischen
Hirten errichtet – etwas, das zuvor als unwahrscheinlich, wenn nicht
sogar unmöglich galt. "Dieser Fund zwingt uns darüber nachzudenken, wie
wir soziale Komplexität definieren", sagt Hildebrand. "Und auch darüber,
welche Motive Menschengruppen dazu bringen, öffentliche Architektur zu
erschaffen."
Halt in schwierigen Zeiten?
Die Archäologen vermuten, dass die schwierige Situation die Hirten zu
einer solchen kollektiven Anstrengung trieb. Denn sie waren nach ihrer
Ankunft am Turkanasee nicht nur mit neuen Umweltbedingungen
konfrontiert, sondern standen nun auch in Konkurrenz zu den bereits dort
ansässigen Fischer-Kulturen.
"Diese Monumente könnten als ein Ort gedient haben, an dem sich diese
Menschen versammelten, ihre sozialen Bindungen erneuertem und den
Zusammenhalt der Gemeinschaft stärkten", mutmaßt Anneke Janzen vom
Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte in Jena. "Der
Informationsaustausch während der gemeinsamen Rituale könnten den Hirten
zudem geholfen haben, mit der sich schnell verändern Umwelt
zurechtzukommen." (Proceedings of the National Academy of Sciences
(PNAS), 2018; doi: 10.1073/pnas.1721975115)
(PNAS/ Max-Planck-Institut für Menschheitsgeschichte, 21.08.2018 - NPO)