Dem Abendland ist der Islam fremd.
Islam und Christentum
Ist die Aufklärung vom Himmel gefallen?
Will der säkulare Staat den Islam integrieren, muss er sich auf seine christliche Herkunft besinnen
Als vor einiger Zeit CVP-Präsident Gerhard Pfister im Interview mit dieser Zeitung den säkularen Rechtsstaat als «christliches Verdienst» bezeichnete, konterte SP-Chef Christian Levrat: «Ich finde es erschreckend, dass es in der Schweiz politische Kräfte gibt, die sich auf eine Religion berufen müssen, um die Werte unserer Gesellschaft zu rechtfertigen.» Denn diese Werte, so Levrat, stammten aus der Aufklärung. Die Aufklärung aber, ist sie plötzlich vom Himmel gefallen? In voraussetzungslosem Raum entstanden?
Allgemeine Rechtsgrundsätze
Ihr Kennzeichen war die Forderung, den eigenen Verstand zu gebrauchen, Autoritäten, auch die der christlichen Offenbarung, zu hinterfragen. Die Aufklärung wurzelte in dem Bewusstsein, dass es Rechtsgrundsätze gibt, die unabhängig vom Willen der Mächtigen und der religiösen Autoritäten gelten und der menschlichen Vernunft zugänglich sind. Ihre institutionelle Voraussetzung waren eine Diskussionskultur als Trainingsfeld dieser Vernunft sowie der akademische Freiraum der Universität, ihr liberaler Impuls die Forderung nach einer definitiven Scheidung von Politik und Religion.
Dies alles ist – unleugbar – auf dem Boden des Christentums gewachsen, der ersten Religion, die aus ihren heiligen Texten keine rechtliche und politische Ordnung ableitete. Die vom Christentum geprägte Zivilisation basiert auf dem römischen Recht, das die Kirche im Mittelalter zu ihrem eigenen, dem Kirchenrecht ausbaute.
Kirchenjuristen erneuerten und transformierten die altrömische Tradition des Naturrechts hin zu einem «ius naturale» als Ergebnis der Fähigkeit der natürlichen Vernunft, Recht und Unrecht zu unterscheiden. Darauf basierend reinigten sie überkommenes germanisches Gewohnheitsrecht von diskriminierenden und antirationalen Elementen, bereiteten so den Boden für das moderne Menschenrechtsdenken. Und die Kirche etablierte Universitäten als akademische Lehr- und Forschungsräume und förderte damit trotz gelegentlichen Widerständen eine Naturphilosophie, aus der die moderne Naturwissenschaft entstand.
Diese entstand nicht im Konflikt mit der Kirche. Der «Fall Galilei» wird deshalb immer wieder genannt, weil er der einzige war. Antikopernikanisch war nicht die katholische Kirche, die von Galilei lediglich wissenschaftliche Beweise verlangte, sondern Luther, der Kopernikus einen Narren nannte, weil sein heliozentrisches System der wörtlichen Auslegung der Schrift widersprach. Es war das Prinzip «sola scriptura», das mit der modernen Wissenschaft in Konflikt stand. Dieser wurde im Protestantismus schliesslich durch Bibelkritik gelöst.
Religionsinterne Aufklärung
In der Frühzeit der Dynastie der Abassiden (750–1258) kannte auch der Islam eine theologische Richtung (der Mu'taziliten), die Vernunft und Glaube in Einklang bringen wollte. Doch wurde sie verdrängt von einer Orthodoxie, die einzig Koran und Scharia-Recht als Quellen der Erkenntnis der Weltordnung zuliessen. Al-Ghazali (1058–1111) schliesslich erklärte, die Suche nach Gesetzen und Ordnung der Natur, ja jegliche rationale Reflexion des Glaubens sei Leugnung von Gottes absoluter Freiheit und Allmacht und somit Blasphemie. Die «griechischen Wissenschaften», speziell die Physik, wurden deshalb aus dem Curriculum der islamischen Schulen verbannt. Dies kam einem «intellektuellen Selbstmord» (Robert Reilly) gleich – mit Folgen in der muslimischen Kultur bis heute.
Christliche Theologie im vergleichsweise autonomen Raum der von der Kirche gegründeten und geförderten Universitäten war – so der Christentumskritiker Herbert Schnädelbach – doch immer auch «religionsinterne Aufklärung im Sinne einer Reflexion und rationalen Durcharbeitung des Geglaubten». Gross war dabei das Interesse an physikalischen Fragen, weshalb die Naturphilosophie zum universitären Curriculum gehörte. Noch Newton titelte sein Hauptwerk: «Mathematische Prinzipien der Naturphilosophie». Die islamische Mathematik, trotz bedeutenden Leistungen auch in der Astronomie, war hingegen kein Weg zur modernen Naturwissenschaft.
Heilsverheissungen
Ohne Christentum und kirchliche Kulturschöpfung hätte es weder diese Entstehungsbedingungen der modernen Wissenschaft gegeben, noch gäbe es die europäische Rechtstradition. Der Kieler Rechtshistoriker Hans Hattenhauer sieht die mittelalterliche Kirche als «Lehrmeisterin des weltlichen Rechts». Unter Historikern unbestritten, war es die sogenannt päpstliche Revolution des Hochmittelalters, die für die moderne Rechts- und Staatsentwicklung die Grundlagen legte. Sie entsakralisierte König- und Kaisertum und erneuerte damit den Dualismus von weltlicher und geistlicher Gewalt.
Das 11. Jahrhundert war die Wende zur Neuzeit. Auch hatte das Christentum, so der Oxforder Historiker Larry Siedentop, «das Individuum erfunden»: Auf der zur Antike konträren Idee, alle Menschen seien gleich, nämlich vor Gott, und als Individuen selbst verantwortlich für ihr Heil, basiert die spätere Kultur der Freiheitsrechte des Individuums.
Die grossen theologischen und zivilisatorischen Leistungen der antiken und mittelalterlichen Kirche sind auch Erbe und Nährboden der aus der Reformation hervorgegangenen Christenheit und damit gemeinsame Wurzel der Moderne. Der säkulare, freiheitliche Staat ist auf dem Humus einer Zivilisation christlicher Prägung gewachsen, ja erst möglich geworden. Die Aufklärung war eine reife Frucht dieser Entwicklung. Als solche war sie begründeter Protest gegen die intolerante und repressive Allianz von Staat und Kirche, wie sie infolge der Glaubensspaltung – als Friedensformel zur Beendung der verheerenden Glaubenskriege, also aus politischen Gründen – im konfessionellen Staat der Neuzeit entstanden war
Der Aufklärung war aber auch der fragwürdige Impetus eigen, Offenbarungsreligion und Kirchenglauben ausmerzen und damit ihre eigenen Voraussetzungen tilgen zu wollen. Das erst brachte ihr die Feindschaft der Kirche ein. Denn der freiheitliche säkulare Staat ist aus dem spannungsvollen Gegensatz von weltlicher Macht und Kirche als Institution des ewigen Heils entstanden. Die Freiheitlichkeit der Moderne war und ist immer dann in Gefahr, wenn sie sich an die Stelle der Kirche setzen, wenn ihrerseits die Politik Heilsverheissungen anbieten will.
Die Staatsvergottung hat das 20. Jahrhundert in Form zweier Totalitarismen schmerzlich erfahren. Eric Voegelin, und danach Emilio Gentile und Hans Maier, nannten totalitäre politische Ideologien deshalb «politische Religionen», Hermann Lübbe bezeichnete sie – phänomenologisch korrekter – als «Anti-Religionen».
Islam als politische Religion
Der Islam dagegen ist eine politische Religion. Seine Schöpfungsordnung ist zugleich die Ordnung des Heils. Eine Scheidung von religiösem und weltlichem Recht, von religiöser und politisch-sozialer Ordnung gibt es nicht im Islam. Er ist nicht, was unsere unter christlichen Voraussetzungen entstandene säkulare Rechtsordnung unter Religion versteht: eine von der politischen, rechtlichen und sozialen Ordnung separate Ordnung des Glaubens an eine Heilswahrheit und eine entsprechende kultische Praxis.
Da für das Christentum Politik, Staat und Recht ihrer Natur gemäss nicht im Dienst ewigen Heils stehen, konnte sich auf seinem Boden – nicht ohne kirchliche Widerstände – ein rechtlich-politischer Begriff von Religionsfreiheit entwickeln, der letztlich auf dem genuin christlichen Dualismus von politisch-rechtlicher und religiöser Ordnung beruht.
Dieser Dualismus, dem im Zeitenlauf zwar oft zuwidergehandelt wurde, steht im Widerspruch zum Wesen des Islam als integrale religiöse, politische, rechtliche und soziale Ordnung. Daher rührt die Mühe im Islam, das Ethos anzuerkennen, aufgrund dessen wir in einer vom Christentum geprägten Kultur zu leben gelernt haben: dass Menschen verschiedenen Glaubens und unterschiedlicher Moralvorstellungen auf der Grundlage eines Gefüges von religionsunabhängigen, säkularen rechtlichen Regeln und auf der Basis bürgerlicher Gleichheit zusammenleben. Dieses Ethos verlangt keine bestimmte Gesinnung, wohl aber die Befolgung von Regeln und überlässt, vereinfacht gesagt, alles andere dem Freiraum der Privatsphäre.
Die grösste Herausforderung, mit der die freiheitliche westliche Gesellschaft sich künftig auseinandersetzen muss, ist nicht die Gewalttätigkeit der politisch extremsten Spielarten des Islam. Sie besteht vielmehr darin, dass die Anerkennung des säkularen Ethos bürgerlichen Zusammenlebens dem politisch-religiöses Selbstverständnis aller Varianten des Islam widerspricht. Um dieses Problem zu lösen, müsste der Islam von einer politischen zu einer rein religiösen Religion werden – was nicht völlig unmöglich ist, wie die Geschichte etwa des Balkans zeigt.
Der Islam wird zu Europa gehören. Ob und wie sein Selbstverständnis sich modifizieren wird, hängt davon ab, wie sehr die Menschen muslimischen Glaubens sich in unsere Gesellschaft integrieren können und wollen. Integration und die damit verbundene, zumindest partielle Assimilation der Lebensweise bewirkt kulturelle Veränderung. Diese müsste die Abkehr vom politischen Verständnis der eigenen Religion einschliessen und damit eine unzweifelhafte Anerkennung des Primats der freiheitlich säkularen Rechtsordnung über die Scharia.
Falsch verstandene Toleranz
Der Westen wird der Herausforderung des vermehrt in seinen Gesellschaften präsenten Islam nur gewachsen sein, wenn er nicht die christlichen Wurzeln seiner politischen und rechtlichen Kultur verleugnet. Das ist nun keineswegs ein Ruf nach einer neuen christlichen Leitkultur. Vielmehr ist es die vom Christentum und seiner Scheidung von Politik und Religion ermöglichte säkulare «Leitkultur» des freiheitlichen Rechtsstaates, der sich gegenüber religiösen Wahrheitsfragen sowie der religiösen Zugehörigkeit seiner Bürger indifferent verhält.
Eine solche Leitkultur gilt es von Muslimen wie von allen Bürgern einzufordern, wobei allen, Muslim oder nicht, die gleichen Rechte und gleiche Behandlung zustehen. Das allerdings setzt voraus, dass der Westen an seinem christlich fundierten Verständnis von Religion festhält und es unverrückbar allen Tendenzen entgegensetzt, die – im Namen falsch verstandener Religionsfreiheit und Toleranz – eine mit unserem Rechtsverständnis inkompatible Islamisierung der Gesellschaft zuzulassen bereit sind.
Eine sich auf die religionsfeindlichen Aspekte der Aufklärung berufende Ächtung religiöser Heilsverheissungen als freiheitsfeindlich hingegen hätte totalitäre Züge. Sie würde indirekt den Staat überhöhen und eine säkular-freiheitliche politische Kultur untergraben. Diese lebt ja gerade vom Gegenüber heilsverheissender Institutionen. Sie bewahren den Staat – im Interesse der Freiheit – davor, selbst soziale oder politische Heilsversprechen anbieten zu wollen.
Martin
Rhonheimer ist katholischer Priester, Professor für Ethik und
politische Philosophie an der Päpstlichen Universität Santa Croce (Rom)
und Gründungspräsident des Austrian Institute of Economics and Social
Philosophy (Wien). Zum vorliegenden Thema veröffentlichte er das Buch
«Christentum und säkularer Staat», Freiburg i. Br. 2012.
Nota. - Lebt unsere säkular-freiheitliche politische Kultur davon, dass ihr in Gestalt der Amtskirchen heilsver- heißende Institutionen gegenüberstehen, weil sonst die Menschen wieder versucht werden könnten, ihr Heil beim Staat zu suchen? Ich denke, wenn wir den säkular-freiheitlichen Charakter unserer politischen Kultur recht pflegen und kultivieren wollten, würden die Menschen vielleicht gar nicht mehr ein Heil suchen.
Das kann der römische Priester bei Strafe der Selbstaufgabe natürlich nicht für möglich halten, und ich will es ihm auch nicht zumuten. Dass es die Kirchen in ihrem christlich-dualistischen Verständnis gibt, muss den ungläubig-Gottlosen nicht verdrießen, denn in der Sache hat Pater Rhonheimer natürlich Recht. Die Scheidung zwischen geistlichem Heil und weltlichem Recht ist allein im Christentum geschehen, und gewiss waren einige seiner dogmatischen Grundlagen geeignet, sie möglich zu machen.
Rhonheimer erwähnt es nicht, es gehört nicht zu seinem Amt, aber ich darf darauf hinweisen, dass die relative Selbstbescheidung der Kirchen weniger ihr eignes frommes Verdienst ist, sondern wohl eher dem Widerstand, gar der Aggression der weltlichen Mächte zu danken ist, wenn sie die Allmacht, die sie doch immer wieder mal beanspruchten, nie erringen konnten; so wie es den westlichen Kirchen zu danken haben, dass die Despotie keine europäische Herrschaftsform wurde, sondern auf Asien beschränkt blieb. Ein Blick nach Russland erhellt: Die deutschen Könige von Rom konnte nicht zu Selbstherrschern aller Abendländer werden, weil sie die römi- schen Bischöfe hindern mussten, es zu werden.
Ehe der Islam ein Teil Europas wird, müsste er sich entorientalisieren. Er ist eine asiatische Religion in dem Sinn, dass nie ein Herrschender und schon gar kein zur Herrschaft Drängender es im Orient je versäumt hat, sich der koranischen Formeln zu bedienen, so wie keine islamische Institution und nicht einmal die Sufi-Orden je darauf verzichtet hat, aufs Leben des Gemeinwesens Einfluss zu nehmen. Das müsste schon eine ganz andere Religion werden, die sich nicht auf die Menge ihrer Vorschriften, sondern auf die Fülle ihrer Glaubensinhalte gründete. Ginge das mit dem Koran überhaupt?
Bis dahin sind wir wirklich Ungläubigen gehalten, dem Einsickern des Islam in Europa entschiedener entgegen- zutreten als die Vertreter der christlichen Kirchen. Für die ist das eine Konkurrenz. Für uns ist das ein Gegner.
JE
Der Islam gehört nicht zu Europa.
Die Schlacht von Uhud:
Mohammed und die Seinen kämpfen gegen den mekkanischen Stamm der Quraisch.
Kopie einer 1594 entstandenen Illustration zu einem Epos über das Leben des
Propheten.
aus nzz.ch, 6.9.2014, 05:30 Uhr Gewalt und theologische Tradition im Islam
Töten im Namen Allahs
Islamistische Terroristen berufen sich zur Rechtfertigung ihrer Untaten auf ihre Religion. Geben Gründungsgeschichte und Gründungsidee des Islam eine Handhabe, um im Namen Allahs begangene Gewalttaten theologisch prinzipiell zu verurteilen? Nein – der Islam müsste sich erst in seiner religiösen Substanz wandeln.
Der Terror der Miliz Islamischer Staat (IS) gegen «Ungläubige» und Christen entsetzt und verängstigt die westliche Öffentlichkeit. Offizielle muslimische Stimmen, die diesen Terror verurteilen, sind wenige zu hören. Und wenn, dann richten sie sich nur gegen die schockierende und für den Islam imageschädigende Brutalität des Vorgehens, nicht gegen dessen Prinzip, oder sie verwickeln sich, wie unlängst eine wenig überzeugende Fatwa von britischen Imamen, in Widersprüche. Der IS ist keine Häresie, wie diese Fatwa behauptet, sondern handelt genau nach dem in der Geschichte wiederkehrenden Muster kriegerischer islamischer Expansion. Das Vorbild ist Mohammed selbst. Legitimationsgrundlage sind der Koran und das islamische Recht, die Scharia.Eine politische Religion
Der IS-Chef Abu Bakr al-Baghdadi hat sich bekanntlich zum Kalifen ernannt. In einem von dem zum Islam konvertierten Amerikaner Nuh Ha Mim Keller ins Englische übersetzten Kompendium der Scharia – es wurde von der Al-Azhar-Universität in Kairo als authentisch zertifiziert – kann man nachlesen, was Aufgabe eines Kalifen ist: «Der Kalif führt gegen Juden, Christen und Zoroastrier Krieg, nachdem er sie zuerst eingeladen hat, sich der sozialen Ordnung des Islam zu fügen, indem sie die Kopfsteuer zahlen.» Exakt das geschieht heute im Herrschaftsgebiet des IS. Die dort lebenden Christen sollen gedemütigt und unterworfen und durch die Kopfsteuer zur wirtschaftlichen Ressource islamischer Herrschaft werden. Mohammed hatte zunächst die Juden aus Medina vertrieben, dann liess er sie massenhaft köpfen. Später wurden Christen und Juden zu «Schriftbesitzern» erklärt: Sie durften nun unter islamischer Herrschaft ihre Religion weiter ausüben – sofern sie die Kopfsteuer zahlten und sich diskriminierenden Demütigungen aller Art unterwarfen. So steht in Sure 9, 29: «Kämpft gegen diejenigen, die [. . .] nicht der wahren Religion angehören – von denen, die die Schrift erhalten haben – kämpft gegen sie, bis sie kleinlaut Tribut entrichten.»
Zu Beginn waren die Muslime im muslimischen Herrschaftsgebiet meistens eine Minderheit. Ihre Herrschaft gründete auf der grossen Zahl der «dhimmis», der «Schutzbefohlenen». Juden, Christen und andere «Schriftbesitzer» galten nicht als «Ungläubige»: Sie konnten als «dhimmis» ihr Leben behalten, auch wenn sie keine Muslime wurden. Die heute vom IS gejagten Jesiden gelten nicht als «Schriftbesitzer», für sie gibt es daher nur die Alternative: Konversion zum Islam oder Tod. Die islamische Theologie besitzt keine argumentativen Ressourcen, um das Vorgehen des IS als «unislamisch» zu verurteilen. Es gibt im Islam nämlich kein generelles Tötungsverbot. Es gibt hingegen eine generelle Tötungslizenz: «Ungläubige», die sich der Konversion zum Islam widersetzen, sollen getötet werden. So heisst es in Sure 9, 5: «. . . tötet die Heiden, wo immer ihr sie findet, greift sie, umzingelt sie und lauert ihnen überall auf! Wenn sie sich aber bekehren, das Gebet verrichten und die Almosensteuer geben, lasst sie ihres Weges ziehen! Gott ist barmherzig und bereit zu vergeben.»
Der Islam ist seinem Wesen nach mehr als eine Religion. Er ist ein kultisches, politisches und soziales Regelwerk, will religiöse und politisch-soziale Ordnung in einem sein. Und er war von Anfang an kriegerisch. Der Islam will das «Haus des Islam» auf der ganzen Welt verbreiten. Es geht ihm dabei nicht so sehr um religiöse Bekehrung der Nichtmuslime als um ihre Unterwerfung unter die Scharia. In Sure 2, 256 heisst es: «In der Religion gibt es keinen Zwang.» Glaube lässt sich eben nicht erzwingen, Unterwerfung unter das islamische Recht aber sehr wohl. Sich diesem Zwang zu widersetzen, kann tödlich sein. Historisch war die islamische Einheit von Politik und Religion zwar meist nur Programm und selten Realität. Andere politische Machtzentren entstanden, die sich nicht unter der geistlichen Führung eines Kalifen befanden. Und gemäss islamischer Lehre konnte der Kampf (Jihad) gegen die Nichtmuslime genau dann unterbrochen und mit den Ungläubigen ein Waffenstillstand geschlossen werden, wenn für weitere Expansion keine Aussicht auf Erfolg bestand. Das führte zu langen und oft friedlichen Perioden der Koexistenz. Zudem sind muslimische Minderheiten in nichtmuslimischen Ländern verpflichtet, sich an die lokale Rechtsordnung zu halten.
In unseren westlichen Gesellschaften gibt es unzählige integrierte Muslime, die nichts vom Jihad wissen wollen; und selbst in Ländern mit muslimischer Bevölkerungsmehrheit lässt sich nur ein kleiner Teil für ihn begeistern. Die meisten Leute kämpfen um ihr tägliches Brot und sind oft selber Opfer von Gewalt. Doch gerade sie sind auch anfällig für Radikalisierung – und zwar genau dann, wenn sie die Quellen ihrer Religion genauer studieren und angesichts der Erstarkung des politisch radikalen Islam auf den Gedanken kommen, die Zeit der Waffenruhe könnte vorbei und Gewaltanwendung wieder Pflicht sein.
Christliche Parallelen?
Natürlich gibt es den «gemässigten» und reformerischen Islam. Seine Vertreter sind meist gutbezahlte Professoren an amerikanischen und europäischen Universitäten. Doch auch sie sind mit dem zentralen Problem ihrer Religion konfrontiert: Gehen sie zu ihren Ursprüngen zurück, stossen sie auf den kriegerischen, expansiven Islam von Medina, die Legitimierung des Tötens zur Ehre Allahs und einen gewalttätigen Mohammed. Hier gibt es einen wesentlichen Unterschied zum Christentum. Auch in seiner Geschichte spielte Gewalt eine gestaltende Rolle und wurde als «gerechter Krieg» oder zur Verteidigung der religiösen Wahrheit gegen Ketzer legitimiert. Auch Christen haben in der Vergangenheit gemordet und gebrandschatzt. Kriegsrecht und Foltermethoden waren brutal. Beschäftigt man sich jedoch mit den ursprünglichen Quellen des Christentums, etwa den Evangelien, findet man Sätze Jesu wie «Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und Gott, was Gott gehört» oder «Alle, die zum Schwert greifen, werden durch das Schwert umkommen». Zur Gründungsidee des Christentums gehören die Scheidung von Religion und Politik – von geistlicher und weltlicher Macht –, die Ächtung physischer Gewalt und das Gebot der Feindesliebe. Das Christentum hat aus seinen heiligen Texten auch keine Rechts- und Sozialordnung abgeleitet, sondern römisches Recht und heidnisch-antike Kultur assimiliert. Die mannigfachen Verbindungen von Politik und Religion gingen meist nicht von der Kirche, sondern von den weltlichen Machthabern aus. Gerade der dem Christentum in die Wiege gelegte Dualismus von «geistlich» und «weltlich» provozierte immer wieder innerkirchliche Reformbewegungen, die zu Prozessen der institutionellen Differenzierung und Selbstreinigung führten.
In der jüdisch-christlichen Tradition ist Gewalt rechtfertigungsbedürftig. «Du sollst nicht töten», heisst es im Dekalog. Ein solch grundsätzliches Tötungsverbot ist dem Islam unbekannt. In der jüdischen und christlichen Bibel erscheint Gott als der alleinige Herr über Leben und Tod. Kein Mensch kann sich das Recht zum Töten anmassen. Oft wird das Alte Testament – auch in antisemitischer Absicht – als Beispiel für Grausamkeit und Gewaltlegitimation angeführt. Das Gegenteil ist wahr: Der Gott Israels entzieht dem Menschen die Kompetenz zum eigenmächtigen Töten. Im Christentum führte die Erfahrung des Unglaubens nicht zum Aufruf, die Ungläubigen zu töten, sondern zum Missionseifer und – nach der Entdeckung Amerikas – zu Gestalten wie Vitoria und Bartolomé de las Casas: In der christlichen Tradition stehend machten sie geltend, dass Ungläubige als Menschen die gleichen grundlegenden Rechte besitzen wie Christen. Dabei wurden sie von päpstlichen Verlautbarungen unterstützt (obwohl die spanischen Könige deren Verbreitung zu verhindern suchten).
Und hier liegt der entscheidende Punkt: Für den Islam sind Nichtmuslime keine vollwertigen Menschen. Denn islamischer Lehre gemäss ist der Mensch von Natur aus Muslim, die menschliche Natur selbst, die «fitra», ist muslimisch. Nichtmuslime sind folglich Abtrünnige, «denaturierte» Menschen. Im Islam kann es deshalb keine prinzipielle Gleichheit aller Menschen aufgrund ihrer Natur und kein für alle – unabhängig von der Religionszugehörigkeit – geltendes Naturrecht geben. Der Islam akzeptiert die modernen Menschenrechte immer nur unter dem Vorbehalt der Bestimmungen der Scharia. Deshalb kann sich gerade der «wahre Islam» nicht in die Moderne integrieren.
Schwierige Selbstreinigung
Die modernen Menschenrechte sind eine Frucht der jüdisch-christlichen Zivilisation. Deren Vermächtnis ist die Anerkennung einer allen Menschen, unabhängig von ihrer Religion, gemeinsamen Menschennatur und Würde. Ihr Ethos von Recht und Barmherzigkeit führte, in einem stetig fortschreitenden Lernprozess, zu einer allmählichen Überwindung der Legitimation von Gewalt – auch ihrer theologischen Legitimation. Analoge Aufklärungsprozesse sind im Islam unbekannt oder haben zumindest noch kaum Wirkung entfaltet. Die Barmherzigkeit Allahs gilt nur den Bekehrten, gegen die Ungläubigen befiehlt er, mit dem Schwert vorzugehen. Darin gründet die theologische Not muslimischer Intellektueller: Sie können aufgrund ihrer religiösen Tradition den IS-Terror nicht prinzipiell verurteilen. Die christlichen Kirchen konnten für Prozesse der Selbstreinigung immer auf ihre Ursprünge rekurrieren und, sich an ihre Gründungsidee erinnernd, historischen Ballast abwerfen. Der Islam müsste sich für solche Selbstreinigung – gerade umgekehrt – von seiner Gründungsidee distanzieren, sein politisch-religiöses Doppelwesen aufgeben und sich damit in seiner religiösen Substanz verändern.
Solange das nicht geschieht, wird es immer nur eine Frage der konkreten politischen Konstellation sein, ob und in welcher Form er sein gewalttätiges Gesicht zeigt.
Martin Rhonheimer ist Professor für Ethik und politische
Philosophie an der Päpstlichen Hochschule Santa Croce in Rom. Zum Thema vgl.
sein in dritter Auflage erschienenes Buch «Christentum und säkularer Staat.
Geschichte – Gegenwart – Zukunft» (Herder, Freiburg i. Br. 2012).
Nota. - Im Abendland leben einige Millionen Muslime. Die gehören zum Abendland. Denn dass sie hier unbehelligt ihre Religion und manche ihrer Traditionen - aber nicht das Steinigen von Ehebrecherinnen - pflegen können, gehört zu seinem Kernbestand. Der Islam gehört nicht zu seinem Kernbestand.
JE
Nicht die Stagnation des Islam gilt es zu verstehen, sondern den Dynamismus der christlichen Welt.
Geschichte der Toleranz
Eine Reformation im Islam ist sinnlos
Der Islam kannte keine Aufklärung, so lautet ein gängiger Vorwurf. Aber er hatte sie auch gar nicht nötig - bis der Westen kam.
Gastbeitrag von Frank Griffel
Wenn im kommenden Jahr Luthers Reformation gefeiert wird, denken viele auch an den Islam. Die Probleme moderner islamischer Gesellschaften werden häufig damit erklärt, dass es im Islam keine Reformation und keine Aufklärung gab. Die Aufklärung gilt dabei als Zurückdrängung der Religion und Stärkung einer davon unabhängigen philosophischen Tradition.
Nach dem Untergang der arabischen Philosophie im Mittelalter fehle dem Islam ein Gegenpol zur Macht des Religiösen, wird oft beklagt. Neue Ansätze in der Islamwissenschaft aber versuchen zu zeigen, dass dem nicht so war, ja, dass es im Islam vor der Konfrontation mit dem Kolonialismus nie eine Situation gab, in der - wie in Europa - Reformation und Aufklärung nötig waren.
Seit ihrer Etablierung im frühen 19. Jahrhundert war die Erforschung der Philosophie im Islam ein Kernthema der westlichen Orientalistik. Hegel hatte noch abwertend über die Philosophie der Araber gesprochen. Aus der Generation nach ihm stammt eine Studie des französischen Religionsphilosophen Ernest Renan ("Averroès et l'averroïsme"), in der dieser die Philosophie des muslimischen Denkers Averroes, arabisch: Ibn Ruschd untersuchte.
Renan prägte darin das westliche Bild der Philosophie im Islam. Er behauptete, dass diese nach den Übersetzungen der griechischen Texte ins Arabische und nach großen Erfolgen in der klassischen Periode des Islam mit Averroes' Tod1198 unterging. "Mit ihm verlor die arabische Philosophie ihren letzten Vertreter," so Renan 1861, "und der Triumph des Korans über das freie Denken war für die nächsten sechshundert Jahre besiegelt."
Ganz im Sinne von Hegels wandelndem Weltgeist ging die Philosophie demnach zuerst von den Griechen zu den Arabern und kam dann mit den lateinischen Übersetzungen der Werke Averroes' im 13. Jahrhundert nach Europa. Wollte sie je nach Arabien und zum Islam zurückkehren, so meinte Ernest Renan, dann nur, wenn sich die Muslime die europäische Denkweise der Aufklärung aneigneten und damit die Herrschaft des Korans durchbrächen.
Politische Entmündigung der islamischen Welt problematisch
Renans Sicht setzte sich im Westen leicht durch. Nicht nur legitimierte sie den Kolonialismus und die politische Entmündigung der islamischen Welt, sie erklärte auch die scheinbar untergeordnete Stellung der islamischen Welt als einer Kultur, die sich selber ihrer Philosophie entledigt hatte und sie nun von Europa wieder erwerben musste. Um - erneut - in das Gefüge der zivilisierten Welt aufgenommen zu werden, muss der Islam sich reformieren und die Werte der Aufklärung annehmen.
1937 aber veröffentlichte der damals 29-jährige Islamwissenschaftler und Philosoph Shlomo Pines in der indischen Zeitschrift Islamic Culture einen Aufsatz, in dem er eine grundsätzliche Abkehr von dieser Darstellung vorschlug. Pines' Artikel hieß "Some Problems of Islamic Philosophy", war seiner Zeit um Jahrzehnte voraus und wird erst heute aufmerksam gelesen. Pines bestritt zuallererst, dass mit Averroes die Geschichte der Philosophie im Islam ihr Ende gefunden hatte.
Und er bot eine neue Sichtweise auf den einflussreichen Religionsgelehrten Mohammed al-Ghasali: Dieser habe nicht, wie oft behauptet, der Philosophie im Islam den Todesstoß versetzt. Im Gegenteil, wie man heute weiß: Dank al-Ghasalis Kritik entstand eine neue Art Philosophie, in der die alte Tradition griechischer Prägung neben einer neuen existierte. Diese neue Tradition der Philosophie im Islam hatte über Jahrhunderte Bestand und wird heute als "nachklassische Philosophie" des Islams eifrig erforscht. In ihr greifen Philosophie und Theologie ineinander. Diese nachklassische Periode reicht etwa von 1100 bis 1800.
Einer der einflussreichsten Theologen dieser Epoche beispielsweise, Fachraddin ar-Razi, war einer der scharfsinnigsten Interpreten des Aristoteles und verfasste sowohl einen wirkungsmächtigen Koran-Kommentar wie auch wichtige philosophische Enzyklopädien.
Im Gegensatz zur europäischen Philosophie zeichnet sich diese Tradition durch ein größeres Maß an Synthese aus. Pines hatte dies schon 1937 erkannt, als er schrieb, dass es den nachklassischen muslimischen Philosophen "in keiner Weise an neuen Ideen mangelte; sie waren oft jedoch damit zufrieden, sie in die alten Systeme einzubauen".
Gleichzeitig, so Shlomo Pines, war diese nachklassische Philosophie im Islam stabiler, weil sie durch Synkretismus bestimmt war, also durch das Ineinanderwirken verschiedener Traditionen, ohne dass sich diese bekämpften. "Die islamische Zivilisation war verschiedenen orientalischen, persischen und indischen Einflüssen ausgesetzt und enthielt schon von vornherein eine größere Anzahl von Elementen unterschiedlicher Herkunft als die europäische. In ihrer weiteren Entwicklung hat sie im Fall eines Konfliktes zwischen zwei philosophischen Systemen in der Regel nicht eines davon eliminiert, sondern sie ließ beide - entweder Seite an Seite oder auf verschiedenen Ebenen - bestehen."
Damit gilt für die Philosophie in der islamischen Welt gerade nicht, was Hegel als Regel der Philosophiegeschichte überhaupt postuliert hatte: dass sich nämlich im Konflikt zweier Denksysteme ein drittes, neues durchsetzt, das dann die vorherigen "aufhebt". Diese Hegel'sche "Dialektik" hat Generationen von Wissenschaftshistorikern im Westen beeinflusst.
Sie ist zudem ein Bestandteil der These des Wissenschaftsphilosophen Thomas Kuhn, nach der sich Phasen der Normalwissenschaft mit kurzen, wirkungsreichen wissenschaftlichen Revolutionen abwechseln. All dies gehört heute zum Selbstverständnis des wissenschaftlichen Fortschritts im Westen, den dieser als Fortschritt der Menschheit überhaupt versteht.
Eine Gesellschaft auf der Suche nach Ausgleich
Im Verlauf des letzten Jahrzehnts entstand in der Islamwissenschaft aber eine Sichtweise, die von einem grundsätzlich anderen Wesen der islamischen Geisteskultur vor ihrer Zerstörung durch den europäischen Kolonialismus ausgeht. So schrieb beispielsweise Wael Hallaq, Professor für islamisches Recht an der Columbia Universität in New York, 2012 in seinem Buch "The Impossible State", dass die klassische islamische Scharia, so wie sie vor 1800 in Ägypten oder Syrien praktiziert wurde, ein auf ihre Gesellschaften abgestimmtes Rechtssystem war.
Was Konfliktlösungsstrategien angeht, sei sie ihrem westlichen Pendant überlegen gewesen. Das Geheimnis ihres Erfolges lag darin, nicht wie im westlichen, vor allem europäisch-kontinentalen Rechtsdenken, eine einzige Lösung für streitende Parteien oder konkurrierende Rechtsprinzipien anzugeben, sondern mehrere. Alle konnten mit gleicher Legitimität abgeleitet werden.
Solche Rechtspraxis spiegelt eine Gesellschaft wider, in der es keine radikalen Verwerfungen wie die kopernikanische oder die französische Revolution gab. Hier gab es keine Aufklärung, keinen Aufruhr gegen die Religion, stattdessen war sie geprägt von Synthesis und der Suche nach Ausgleich. Hier verband sich Religion etwa erfolgreich mit Philosophie, ja, sogar mit Freidenkertum und dem Herumstreunen halb nackter Derwische. Die "Kalandars" beispielsweise waren so etwas wie eine islamische Hippie-Bewegung, die sich den etablierten Normen widersetzten.
Es war dies eine Gesellschaft, in der es keinen Mainstream, sondern vor allem Nischen gab, schwach abgegrenzte Bereiche, in denen die Sufis ebenso ungestört ihre Kreise drehen konnten, wie die Astronomen neue Theorien von Planetenbewegungen ausprobierten- alle im geozentrischen Modell natürlich.
Dies mag sich nicht mit dem westlichen Anspruch nach Fortschritt vertragen. Es führte jedoch zu Gesellschaften, die von Toleranz geprägt waren, in denen die Literatur und die Künste florierten und die eine Vielzahl von Rollenmodellen anboten. Für europäische Beobachter, die an ihnen nicht teilhatten, waren sie aber nichts anderes als rückständig und arm, verdammt dazu, ihre eigenen Werturteile aufzugeben und die des Westens anzunehmen.
Muslimische Gesellschaft passt sich seit Jahrhunderten an
Militärische Siege, vereint mit der Strahlkraft des materiellen Fortschritts westlicher Industrialisierung, führten denn auch zum schnellen Ende dieser Organisationsformen und Denktraditionen. Sie schafften sich im Verlauf des 19. Jahrhunderts quasi selber ab, ersetzten ihre alten Madrasas mit Polytechniken französischer Prägung, verdrängten die Scharia zugunsten adaptierter Versionen des Code Napoléon sowie schweizerischer Gesetzbücher.
Wer heute fordert, dass sich der Islam reformieren und an den Westen anpassen muss, vergisst, dass das gesamte 19. Jahrhundert und frühe 20. Jahrhundert für muslimische Gesellschaften ein einziger Anpassungsprozess war. Europäische Bildungssysteme, Lehrbücher sowie Verfassungen und Gesetzesbücher wurden übernommen.
Manche Länder wie die Türkei übernahmen gar ein europäisches Alphabet und schnitten sich von ihrer Geschichte und Literatur ab, die bald niemand mehr lesen konnte. Alles Islamische galt als hinderlich auf dem Weg in die Moderne. Am Ende dieser Entwicklung standen geistig entwurzelte Gesellschaften, die jedoch - weil sie nach wie vor muslimisch geprägt waren - vom Westen weiterhin nicht als vollwertig anerkannt wurden und werden.
Ein wichtiger Beitrag zum Verständnis der vormodernen muslimischen Geisteskultur findet sich auch in Thomas Bauers Buch "Die Kultur der Ambiguität" aus dem Jahr 2011. Darin beschreibt er, wie in vormodernen islamischen Literaturen mehrere Lösungs- oder Interpretationsvorschläge nebeneinander bestehen konnten. Der gebildete Korankommentator gab eine Vielzahl von Interpretationen an seine Studenten weiter, ohne eine einzige zu bevorzugen.
Der gelehrte Philosoph konnte alle Argumente für oder gegen eine Position so präsentieren, als seien sie seine eigenen. Ja, was schließlich das "Eigene" ist, also die Problemlösung, der sich ein Korankommentator oder Philosoph anschloss, blieb häufig unbeantwortet. Dabei wurde durchaus abgewogen, und die Fülle der Ansätze wurde verglichen und bewertet. Es musste aber nicht eine einzige Lösung, ein einziges Bekenntnis geben, sondern mehrere konnten nebeneinander bestehen.
Vormoderne muslimische Gesellschaften bieten viele Rollenbilder
Für Bauer leiden unsere modernen westlichen Gesellschaften an mangelnder Ambiguitätstoleranz. Wir sind beispielsweise entweder hetero- oder homosexuell und fragen uns automatisch, ob der Dichter arabischer Verse des15. Jahrhunderts, in denen der Genuss der Liebe sowohl mit Männern wie mit Frauen besungen wird, nun auch das eine oder das andere war. Unser Verständnis von Hetero- oder Homosexualität lässt kaum ein drittes zu.
In den vormodernen muslimischen Gesellschaften hingegen standen mehr Rollenbilder, auch diversifiziertere, zur Verfügung. Moderne westliche Beobachter von vormodernen islamischen Gesellschaften sind schlecht ausgerüstet, sie zu verstehen. Ihre Blütenpracht ist für uns oft nichts weiter als ein Meer
Moderne Muslime sind von dieser Vielfalt und Toleranz genauso abgeschnitten wie wir. Heutige muslimische Gesellschaften, so Hallaq, sind nur ein Abklatsch dessen, was sich als islamische Kultur über Jahrhunderte herausbildete. Wer sie heute mit der Wiedereinführung der Scharia zurück in ideale muslimische Gesellschaften verwandeln will, kann nur scheitern. Ein moderner Staat, der von der Scharia geprägt ist, wird so zu einem Ding der Unmöglichkeit. Er ist Hallaqs "unmöglicher Staat" und muss seine Unzulänglichkeit mit totalitären Mitteln überspielen.
Der fundametalistische Islam ist intolerant
Niemand würde auf die Idee kommen, das Leben unter dem selbsternannten "Islamischen Staat" als geprägt von Toleranz und einer Großzahl von Rollenentwürfen zu bezeichnen. Ganz im Gegenteil. Der fundamentalistische Islam ist intolerant und lehnt die Vielfalt der vormodernen muslimischen Gesellschaften ab.
Aber es ist eben auch ein Fehler, im islamischen Fundamentalismus eine Rückkehr in die muslimische Vergangenheit zu sehen. Tatsächlich entstand islamischer Fundamentalismus erst im Verlauf des letzten Jahrhunderts aus einer modernen Bewegung, die sich bewusst gegen traditionelle Gesellschaftsentwürfe im Islam richtete. Auch den muslimischen Fundamentalisten gelten die vormodernen islamischen Gesellschaften des 18. Jahrhunderts als rückständig und korrupt.
Sie werden - nicht zu Unrecht - für die militärischen Niederlagen gegen die Europäer verantwortlich gemacht. Ambiguität verträgt sich nicht gut mit militärischer Disziplin einer modernen Armee. Der fundamentalistische Islam al-Qaidas und des IS fordert aber ebenjene militärische Disziplin von seinen Anhängern, wie auch das Bekenntnis zu einer einzigen Art, den Koran zu lesen - ohne andere auch nur zu kennen.
Die oft gehörte Forderung, der Islam müsse sich reformieren und die Werte der Aufklärung übernehmen, ist aus der Kenntnis vormoderner islamischer Gesellschaften heraus sinnlos. Unser Verständnis vom Niedergang muslimischer Gesellschaften nach ihrer angenommenen klassischen Blütezeit - also um 1200 nach Christus - ist verfehlt. Sicher, nachklassische islamische Gesellschaften hatten auch ihre Probleme - autoritäre Strukturen und Mangel an politischer Partizipation etwa -, aber sie waren frei von den Missständen, die in Europa die Reformation und die Aufklärung zur Folge hatten, und damit auch frei von der Gewalt, die diese Umwälzungen erzeugten.
Der nachklassische Islam kennt keine Hexenverbrennungen
"Weder gab es einen organisierten Klerus", schreibt Bauer, "noch eine Unterdrückung von Philosophie und Naturwissenschaften und auch keine Ketzerprozesse gegen Rationalisten." Hier hat die westliche Islamwissenschaft der letzten zwei Jahrhunderte einen falschen Eindruck erweckt: Der nachklassische Islam kennt keine Hexenverbrennungen, keinen Index verbotener Bücher und keine Religionskriege - alles Phänomene, die Europa plagten.
Vielleicht ist dieser neue Blick auf die vom Kolonialismus zerstörten islamischen Gesellschaften nichts als eine andere Art der Verbrämung, im Islam wieder einmal einen Gegenentwurf zu westlichen Gesellschaften zu sehen, diesmal aber einen positiven, in dem die Übel der Moderne vermieden wurden.
Doch selbst, wenn es eine Romantisierung sein mag, geht sie mit einem kritischen Blick auf das Eigene einher. Es scheint, als habe Europa sein Gegenüber auf der anderen Seite des Mittelmeeres lange missverstanden. Da mag selbst ein idealisierender Blick auf dieses andere - sofern er letztlich der Forderung nach einer Aufklärung des Islam ein Ende setzt - eine willkommene Abwechslung sein.
Frank Griffel ist Professor für Islamwissenschaften an der Yale-Universität und derzeit Gastprofessor an der Ludwig-Maximilians-Universität München.
Nota. - Der Verfasser tut selber, was er bei andern kritisiert: Er wendet eine westliche Kategorie auf eine sehr orientalische Realität an. Er spricht von "Toleranz" so, als habe es im Islam einer Aufklärung nie bedurft, aber das, was er bezeichnet, war nur Indolenz und östliche Schicksalsergebenheit - die allerdings ungeeignet waren, dem Vordringen des dynamischen Okzident Widerstand zu leisten. Nichts anderes behaupten auch die Salafisten. Nein, Eklektizismus und die Schläue, sich überall die Rosinen rauszupicken, sind das Gegenteil von kritischem Geist, der Wissenschaft (und übrigens die Kant'sche Selbstbeschränkung der Philosophie) erst möglich macht.
Es ist, glaube ich, ein Holzweg, nach den Faktoren zu suchen, die den Islam gehindert haben, aus sich heraus eine Entwicklungsdynamik zu entfalten, wie sie der Westen seit Reformation und Aufklärung gekannt hat. Das ist ja gerade Eurozentrismus: die westliche Geschichte als den Normalfall anzusehen, den alle andern verfehlt haben! Der Westen, die bürgerliche Zivilisation, der Kapitalismus waren die Ausnahme, die sich als dem Weiter-so der andern Erdteile überlegen erwiesen hat. Nicht die Gründe für das Zurückbleiben der andern, sondern die Umstände, die Europa (nach ursprünglichem Rückstand!) befähigt haben, den Rest der Welt zu überholen, gilt es zu verstehen; nicht den Konservatismus des Islam, sondern den Dynamismus des Christentums.
Und da haben wir auf der Hardware-Seite ausgerechnet... die Ausbildung eines sakralen Klerikerstandes und seiner Kirche. Nur weil diese als ein Corps konstituiert waren, konnten sie, als die Zeit gekommen war, identifiziert und - aus der weltlichen Herrschaft ausgeschieden werden.
So weit wäre es aber gar nicht erst gekommen ohne die christliche Software: Das Leben des Christen ist eine Pilgerfahrt, auf der er scheitern kann; der Christenmensch (und paradoxer Weise gerade der calvinistische Fatalist!) muss sich vor seinem Gott bewähren, er kann sich nicht in sein Schicksal ergeben wie ein orientalischer Weiser. Er ist selbstverantwortliches Subjekt, und nur so konnte er es werden.
Wenn es auch angesichts von IS und Selbstmörderterrror absurd klingt: Das Christentum ist wesentlich kämpferisch, nicht der Islam; Islam heißt Ergebung.
JE
Islam heißt Unterwerfung, integrieren heißt einordnen.
Therwiler Schule
Muslime werden zum Handschlag gezwungen
Die Religionsfreiheit lässt die Verweigerung des Händedrucks gegenüber einer Lehrerin nicht zu, zeigen rechtliche Abklärungen. Auch ein Facebook-Eintrag eines Therwiler Schülers hat Folgen
von Daniel Gerny
Ein Sturm der Entrüstung erfasste den Kanton Basel-Landschaft und den Rest der Schweiz, als im April bekannt wurde, dass ein Brüderpaar muslimischen Glaubens an einer Therwiler Schule ihrer Lehrerin den Handschlag verweigert. Jetzt stellt die Bildungsdirektion des Kantons aufgrund von rechtlichen Abklärungen fest: Das Verweigern des Händedrucks gegenüber weiblichen Lehrpersonen fällt zwar in den Schutzbereich der Glaubens- und Gewissensfreiheit. Doch die Pflicht zum Händedruck ist zulässig.
Dies, weil «der muslimische Glauben nicht in seinen zentralen Teilen berührt» werde, wenn der Handschlag verlangt werde. Die Therwiler Schule wird gestützt auf die rechtliche Abklärung den Händedruck nun wieder einfordern, heisst es in einer Medienmitteilung. Nach dem Eklat infolge des verweigerten Handschlages hatte die Schule eine vorübergehende Kompromisslösung gefunden und die Schüler generell vom Händeschütteln befreit, um so den Geschlechter diskriminierenden Charakter der religiös begründeten Zurückweisung zu begegnen.
Begründet wird das Obligatorium zum Handschlag auch mit dem wachsenden öffentlichen Interesse an der Integration der zunehmenden Zahl von Muslimen: «Dies gilt sicherlich noch vermehrt aufgrund der jüngsten Terrorereignisse in Europa. Integration verlangt, dass die Stellung der Frau in der hiesigen Gesellschaft anerkannt wird.» Weigern sich die beiden Schüler – Söhne eines den Basler Behörden bekannten Muslims mit radikalen Ansichten – weiterhin, ihrer Lehrerin die Hand zu schütteln, müssen sie mit saftigen Sanktionen rechnen.
Die Baselbieter Bildungsdirektorin Monica Gschwind hat den Leiterinnen und Leiter der kantonalen Volksschulen mitgeteilt, dass in diesem Falle die Sanktionsmöglichkeiten des Bildungsgesetzes zur Anwendung kommen. Neben Ermahnungen der Eltern und disziplinarischen Massnahmen der Schüler sieht es Busse bis zu einer Höhe von 5000 Franken vor. ...
Nota. - In besagter Therwiler Schule herrscht der freundliche Brauch, dass der Lehrer jedem Schüler des Morgens vor Unterrichtsbeginn die Hand schüttelt. Und eben auch die Lehrerin. Die beiden muslimischen Jungen sagten, das verböte ihnen ihre Religion, einer Frau die Hand zu geben. Die Bildungsdirektion von Baselbiet eiert. Es ist weder ihre Sache, zu erwägen, ob diese Auslegung der islamischen Lehren richtig ist, noch, ob sie gegebenenfalls deren "zentralen Teile berührt". Sie müsste schon etwas gründlicher nachdenken.
Das ist aber nicht der Grund, weshalb ich die Sache hier wiedergebe. Sondern weil ich mich frage: Was würde in einem solchen Fall in Deutschland geschehen, wenn es sich um Flüchtlinge handelte? Ich sage Ihnen, was meiner Meinung nach geschehen sollte: Man sollte den beiden Jungen und ihrer Familie sagen, wenn sie in keinem Land leben mögen, wo Schüler ihrer Lehrerin die Hand geben müssen, dann hätten sie nicht in ein solches flüchten sollen; sondern, sagen wir, bei Erdogan unterkommen.
Ach, das brächte aber Multikulti und die Willkommenskultur in Verlegenheit. Hexen verbrennen und Ehebrecherinnen steinigen sind doch schönes altes Volksbrauchtum, sollten wir da nicht tollerant mit umgehen?
Ich sagte es schon: Es war sehr schädlich, das Thema, wie sich Europa auf die kommenden Völkerwanderungen vorbereiten soll, mit gutmenschelndem Gesinnungskitsch zu vermengen. Europa wird ihnen nur gewachsen sein, wenn es integer bleibt - wie sollen sich die Neuankömmlinge denn sonst integrieren können? Sie hätten die alte Heimat verlassen und keine neue gefunden.
*
Es ist aber nicht in Deutschland passiert und es handelt sich offenbar nicht um Migranten, sondern um Ansässige. Da würde sich generell zunächst einmal die Frage stellen: Hat der Islam Anspruch auf dieselben Privilegien wie die einheimischen Kirchen? Ja, das ist ein weites Feld. Deren Privilegien sind das Erbe von zweitausend Jahren. Die Frage ist, was davon nicht inzwischen anachronistisch geworden ist und ersatzlos gestrichen werden kann; aber bestimmt nicht, was davon auf neu Hinzugekommene auszudehnen wäre!
JE
Ein anderes Bild vom Islam?
Ein anderes Bild des Islam
Von Gudrun Krämer
Islam ist in aller Munde, und die Debatte kreist im Wesentlichen um ein Buch – das Buch der Bücher, den Koran. Der Islam wird weithin nur noch als Religion gesehen, nicht als Kultur, die sich zwar mit dieser Religion verknüpft, in ihr aber doch nicht aufgeht. Dementsprechend gelten als die authentischen Vertreter des Islam und der Muslime nur mehr Theologen, Juristen und Imame und, wie es scheint, auch Islamisten unterschiedlicher Couleur. Nicht aber Intellektuelle, Künstler und „ganz normale“ Gläubige, die zwar an Gott und den Propheten glauben, aber deswegen nicht jede Kleinigkeit ihres Lebens am Koran und dem Propheten ausrichten.
Der Islam als Religion hat eine klare Botschaft: Er spricht von dem Einen Gott als dem allmächtigen und allerbarmenden Schöpfer, dem seine Geschöpfe Dank und Gehorsam schulden. Den Namen Gottes dürfen Muslime wie Christen, aber anders als Juden, aussprechen. Und tatsächlich findet sich „Allah“ nicht nur in alltäglichen Wendungen, die hart an die Profanierung reichen können, sondern auch als häufiger Bestandteil männlicher Eigennamen. So großzügig die meisten Muslime mit dem Namen Gottes umgehen – ein Bild von ihm dürfen sie sich ebenso wenig machen wie Juden und Christen. Gott ist für sie im Wortsinn un-begreiflich, nicht darstellbar.
Gott ist sich selbst genug und bedarf seiner Geschöpfe nicht, er ist ihnen aber zugewandt. Wie der Gott der Juden und der Christen hat er Forderungen und Erwartungen an seine Geschöpfe: Er verlangt Anerkennung und Respekt, Verehrung und Gehorsam. Die Gläubigen erkennen dies an. Die wahre Religion, die aus dieser Erkenntnis erwächst, ist der Islam: Hingabe an Gott.
Überzeitliche Gültigkeit der heiligen Schrift
Gott teilt sich den Menschen nach islamischer Lehre mit, ganz allgemein durch Natur und Kosmos, im Besonderen aber durch das Wort, wobei sich Schrift und Rede in höchst interessanter Weise miteinander verbinden. Aus dem Koran selbst leitet sich die Vorstellung ab, im Himmel werde eine Urschrift verwahrt, die „Mutter aller Bücher“, die den Menschen zu unterschiedlichen Zeiten in unterschiedlichen Sprachen offenbart wurde. Die letzte, ultimative Offenbarung ist der Koran, der zunächst rezitiert wurde (das arabische Wort qur’an bedeutet nichts anderes) und einige Zeit nach dem Tod Muhammads als Buch niedergeschrieben wurde. Damit besaßen die Muslime, wie vor ihnen die Juden und Christen, gleichfalls eine heilige Schrift.
- Der Islam gehört nicht zu Deutschland.
- Arabische Aufklärung?
- Vorurteile gegen den Islam?
- Eine Religion der Beliebigkeit.
- Die ursprüngliche Vieldeutigkeit des Islam.
- Das Kalifat.
Wenn Muslime heute gefragt werden, worauf sich ihre Religion stützt, so werden sie in der Regel sagen: auf den Koran als unverfälschte, direkte Gottesrede und die Sunna als die Überlieferung der Aussprüche und Handlungen des Propheten Muhammad, der die göttliche Weisung vorbildlich und verbindlich umgesetzt hat. Beide sind in einen konkreten Zeit-Raum eingebettet – die Westküste der Arabischen Halbinsel in der ersten Hälfte des 7. nachchristlichen Jahrhunderts – und, ebenso wichtig, an die arabische Sprache gebunden. Dennoch sollen sie überzeitlich gültig sein, und diese Spannung zwischen historischer, von niemandem bestrittener Einbettung und überzeitlicher Gültigkeit stellt die Muslime vor eine ähnliche Herausforderung wie die Juden und Christen.
"Der Koran ist ein schwieriges Buch"
Der Islam, so wie er sich im Koran darstellt, tritt ganz explizit als Schriftreligion auf und beurteilt nach diesem Muster alle anderen Kulte und Weltanschauungen. Als Religion gelten demnach nur diejenigen Glaubenslehren, die ebenso strukturiert sind wie er selbst, indem sie den Einen Gott verkünden und eine Offenbarungsschrift besitzen. Nicht umsonst firmieren Juden und Christen im Koran als „Schriftbesitzer“.
Der Koran ist ein schwieriges Buch, schwierig in Hinsicht auf den Inhalt, der keine geradlinige Erzählung enthält, schwierig mit Blick auf die verschiedenen Erzählstile und nicht zuletzt die arabische Sprache selbst, die im Original nicht immer eindeutig zu entschlüsseln und ungemein schwer in andere Sprache zu übertragen ist. Dabei gilt, dass der Koran als Gottesrede im Prinzip allen Gläubigen zugänglich ist, die vielleicht eines Kundigen bedürfen, um einzelne Passagen verstehen zu können, denen aber kein Klerus den Zugang versperrt.
Der protestantische Zug des Islam
Insofern könnte man sagen, dass dem Islam – lange vor der Reformation – ein protestantischer Zug innewohnte. Er bedurfte und bedarf auf jeden Fall keines Martin Luther, um dem gemeinen Mann (und der gemeinen Frau) Zugang zur heiligen Schrift zu verschaffen. Daraus folgt freilich nicht, dass der Koran in der Vergangenheit das Leben und Denken der Muslime in allen Einzelheiten bestimmte. Die meisten richteten sich eher an menschlichen Autoritäten aus, an Schriftgelehrten, Sufis und Heiligen von allerlei Art.
Nie aber war der Koran so präsent wie heute, sei es als Buch, das an jeder Straßenecke zu erwerben ist, sei es als Kalligrafie, sei es als Rezitation in Rundfunk und Fernsehen, im Straßenverkehr, im privaten Umfeld. Seine Allgegenwart ist ein modernes Phänomen, Ergebnis nicht nur der Alphabetisierung, sondern vor allem einer umfassenden Medialisierung. Wenn heute allenthalben das protestantisch anmutende „sola scriptura“ (allein durch die Schrift) ertönt, so ist dies Ausdruck spezifisch moderner Verhältnisse. Es ändert nichts daran, dass der Koran weder ein Handbuch der Ethik noch des Familien-, Straf- und Wirtschaftsrechts ist und dass Weisungen und Gesetze Ergebnis menschlicher Interpretation sind und damit immer zugleich Ausdruck von Machtverhältnissen.
Manche Muslime zeichnen Muhammad
Die meisten Muslime sind heute davon überzeugt, dass Muhammad als Prophet zwar in allen Dingen Vor-Bild ist, man sich aber auch von ihm kein Bild machen dürfe. Das war nicht immer so oder auf jeden Fall nicht in allen muslimischen Milieus: Vor allem aus dem mongolisch-persisch-türkischen Sprach- und Kulturraum sind zahlreiche Buchmalereien erhalten, die Muhammad und andere vom Islam verehrte Propheten darstellen. Manche zeigen ihn mit verhülltem Haupt oder einem goldenen Flammennimbus, andere mit vollem Antlitz. Die Grenze zur Karikatur jedoch, die Muhammad nicht ehrend darstellt, sondern herabwürdigend, war immer klar gezogen. Mir ist keine einzige von Muslimen veröffentlichte Muhammad-Karikatur bekannt.
Das viel diskutierte Bilderverbot im Islam jedenfalls gilt so allgemein nicht, selbst wenn viele Muslime anderer Überzeugung sind. Zunächst stehen nicht Bilder generell zur Diskussion, sondern figürliche Abbildungen in zwei- oder dreidimensionaler Gestalt. Dahinter verbirgt sich die Vorstellung, der Künstler könne versuchen, seiner Figur Odem einzuhauchen und daher, wie Gott, als Schöpfer aufzutreten. Fotografie und Film dagegen gelten weithin als unproblematisch, da hinter ihnen die bloße „Ablichtung“ stehe, kein kreativer Akt. Dem würden Film- und Fotokünstler zwar widersprechen, es öffnet aber selbst in rigiden Milieus Räume. Auch Saudi-Arabien und Iran verwenden seit längerem Passbilder (auch für Frauen), Saudi-Arabien erlaubt zwar keine Kinos, wirbt für das eigene Land und Regime jedoch mit Bildern, und der Islamische Staat setzt zu Werbezwecken ganz gezielt Film und Videos ein.
Heilige Stätten ohne Menschen oder Tiere
Wichtig ist die Unterscheidung in unterschiedliche Räume und Texte: Moscheen und Madrasen, traditionelle höhere islamische Schulen, sowie der Koran und die Prophetentradition enthalten keine figürliche Abbildungen. Architekturzeichnungen, Pflanzen, Arabesken und sonstiges Dekor finden sich in ihnen, aber weder Menschen noch Tiere.
Dagegen sind wichtige Genres der religiösen Literatur wie die Prophetenlegenden, die Erzählung von der Himmelfahrt Muhammads, Darstellungen des Jüngsten Gerichts, des Paradieses und der Hölle nicht selten illustriert, wenngleich die erhaltenen Manuskripte wiederum überwiegend aus dem mongolisch-persisch-türkischen Raum stammen. Die heiligen Stätten der Muslime in Mekka, Medina und Jerusalem sind in Gebets- und Pilgerbüchern, auf Fliesen und Teppichen abgebildet, allerdings ohne Menschen oder Tiere. Paläste, Bäder und Wohnungen als nichtreligiöse Räume dagegen sind und waren in weiten Teilen der islamischen Welt auch mit Figuren geschmückt. Zu den bekanntesten Beispielen zählen vielleicht die Darstellungen der Pilgerfahrt nach Mekka und Medina auf den Außenmauern von Privathäusern.
Wer sich die Freude gönnt, „islamische“ Manuskripte, Bücher, Illustrationen und Kalligrafien zu studieren, wird daran erinnert, dass der Islam neben der Religion eine Kultur ist, für die nicht allein die Theologen und die Ideologen stehen. Der Koran ist in seiner Bedeutung für die Muslime unbestritten, aber der Weg zum Verständnis muslimischen Lebens und islamischer Kultur, gleichgültig ob in der islamischen Welt oder in Europa, führt nicht allein über die Schrift. Die Fixierung auf den Koran und die geradezu obsessive Ausdeutung noch des letzten Nebensatzes (wenn nötig, in deutscher Übertragung) spiegelt das Islamverständnis derer, denen man den Alleinvertretungsanspruch auf den Islam gerne aberkennen möchte.
Die Autorin ist Professorin für Islamwissenschaft an der Freien Universität Berlin. Der Text basiert auf einem Vortrag, den sie kürzlich an der Staatsbibliothek zu Berlin gehalten hat.
Sexualität und Islam.
 Mogulreich, 17. Jhdt.
Mogulreich, 17. Jhdt."Ein kulturelles Erbe wird unterdrückt" Warum wurde Sex in muslimisch geprägten Ländern zum Tabuthema? Der Theologe Ali Ghandour erklärt, was die Kolonialzeit damit zu tun hat - und was Aufklärung für Geflüchtete bringt.
Ein Interview von Nadire Biskin
SPIEGEL ONLINE: Herr Ghandour, in Ihrem Buch beschäftigen Sie sich aus historischer Perspektive mit Erotik im Islam. Welche Bedeutung hatte Sex unter Muslimen vor der Kolonialzeit?
Ghandour: Natürlich ist es schwierig, hier zu verallgemeinern. Aber Sex war um das Jahr 1000 beispielsweise bei den Abbasiden oder später im Osmanischen Reich - also in der heutigen Türkei, in Ägypten und im Irak - positiv konnotiert. Er war weder schmutzig noch unheilig. Dadurch ist zum Beispiel auch eine Sprache entstanden, die Sex und Erotik feiert. Im Deutschen gibt es heute nur die Wahl zwischen medizinischer Fachterminologie und umgangssprachlicher vulgär-scherzhafter Ausdrucksweise. Im klassischen Arabischen hingegen sind Bezeichnungen für Geschlechtsorgane wertfrei, die Vagina als Schimpfwort gab es in den meisten muslimischen Kulturen nicht. Dafür existieren allein für den Penis 114 Synonyme und für das weibliche Geschlechtsteil 99. Manche Sufis, also asketische Muslime und Mystiker, betrachteten Sex sogar als einen Weg der Gotteserkenntnis.
SPIEGEL ONLINE: Gibt es deswegen auch das Versprechen auf 40 Jungfrauen im Paradies?
Ghandour: Nein, das ist ein Mythos. Das steht nirgends im Koran. Es gibt prophetische Überlieferungen, die sind allerdings nicht authentisch. Theologen wissen nur, dass es im Paradies sexuelle Gefühle gibt - wie diese aber konkret aussehen, weiß niemand.
SPIEGEL ONLINE: Galten diese früheren liberalen Vorstellungen auch für Frauen?
Ghandour: Teilweise. Frauen sind und waren auch damals überall benachteiligt, allein weil Männer die Diskurse dominieren, wobei das nicht typisch muslimisch, sondern typisch patriarchal ist. Gleichzeitig gab es in manchen Epochen urbane Räume und Phänomene, wie zum Beispiel Hamams, die als Safe Space für Frauen galten. Dort konnten sie zum Beispiel Sex mit Frauen haben oder eine männliche Geschlechterrolle übernehmen.
Ghandour: Früher war in der muslimisch geprägten Welt, zumindest in den Städten, mehr Gelassenheit, Sex war kein Tabuthema. Man konnte damals als Religionsgelehrter auch Sexgeschichten oder homoerotische Gedichte schreiben; das Sexuelle war in der Gesellschaft präsenter und diverser. Heute hingegen gibt es klare Kategorien, was sein darf und was nicht - ich würde sagen, ein kulturelles Erbe wird unterdrückt.
SPIEGEL ONLINE: Wie kam es dazu?
 Ali Ghandour, Jahrgang 1983, ist islamischer Theologe und
Publizist - unter anderem hat er sich mit Buddhismus beschäftigt. Sein
Buch trägt den Titel "Liebe, Sex und Allah. Das unterdrückte erotische
Erbe der Muslime".
Ali Ghandour, Jahrgang 1983, ist islamischer Theologe und
Publizist - unter anderem hat er sich mit Buddhismus beschäftigt. Sein
Buch trägt den Titel "Liebe, Sex und Allah. Das unterdrückte erotische
Erbe der Muslime".Ghandour: Ein Faktor ist der Imperialismus, der die viktorianischen Vorstellungen in die muslimisch geprägten Länder eingeführt hat. Es wurden bewusst und unbewusst europäische Normen des 19. Jahrhunderts übernommen - zum Beispiel die moralische Idee, dass Geschlechtsverkehr nur der Fortpflanzung und dem Wohl der Nation dienen soll. In Ländern wie Indien oder Algerien zwangen die europäischen Kolonialherren solche Normen auch mit Gewalt auf. Darüber hinaus gab es einen Aufstieg von verschieden Ideologien wie Nationalismus, Kommunismus und Islamismus. Alle haben die Kontrolle des Menschen und seiner Sexualität gemein. Und Kontrolle führt immer zu Verboten.
SPIEGEL ONLINE: Heute werden Muslime in Deutschland häufig mit Frauenfeindlichkeit und Homophobie in Verbindung gebracht.
Ghandour: Eins vorneweg: Frauenfeindlichkeit und Homophobie sind keine Phänomene, die man nur bei Muslimen findet. Es gibt sie überall. Homophobie, wie wir sie heute kennen, ist ein Phänomen, das die Muslime vor dem 19. Jahrhundert nicht kannten. Denn blickt man zurück, wird man feststellen, dass es unter Muslimen früher zum Beispiel einen sehr offenen Umgang mit gleichgeschlechtlichen Beziehungen gab.
SPIEGEL ONLINE: In Deutschland wird immer wieder über Sexualaufklärungsunterricht für Geflüchtete aus muslimischen Ländern diskutiert. Was halten Sie von solchen Kursen?
Ghandour: An sich ist Sexualaufklärung immer gut und zwar für jeden und jede. Das Interessante an der heutigen Sexualmoral unter Muslimen ist die Tatsache, dass sie vielleicht stärker von der europäischen Sexualmoral des 19. und frühen 20. Jahrhunderts als von der eigenen Tradition geprägt ist. Es gab einen Bruch durch den Kontakt mit Europäern, keine eigenständige Entwicklung. Muslime verfielen in eine Schockstarre und reagierten mit Angst auf alles Neue und vor allem auf alles Europäische, es wurde nicht mehr agiert, sondern nur noch reagiert.
SPIEGEL ONLINE: Was kann man jetzt dagegen machen?
Ghandour: Muslime sollten die eigenen vergessenen Traditionen kennenlernen - damit meine ich die eigene sexuelle und erotische Geschichte. Was nicht heißen soll, dass wir zurück in die Vergangenheit sollen. Sondern, dass man das Positive aus der eigenen Geschichte aufgreift, das Negative überwindet und gleichzeitig die aktuelle Wissenschaft einbezieht, natürlich mit einem kritischen Blick. Muslimische Gelehrte sollten Sexualität und Liebe viel mehr thematisieren.
SPIEGEL ONLINE: Was sollten Muslime selbst verändern, wenn es um Sex und Liebe geht?
Ghandour: Mehr sexuelle Freiheiten zulassen. Die gemeinschaftliche Kontrolle und die Einschränkung der Sexualität der Menschen durch Normen, die aus völlig anderen Zeiten stammen, sind heute teilweise kontraproduktiv. Es ist wichtig, die Möglichkeiten und Erkenntnisse unserer Zeit zu nutzen und in das Gerüst von muslimischen Normen zu integrieren. So ein Prozess ist muslimischen Denktraditionen auch nicht fremd. Er wurde nur verlernt.
Nota. - Um erotische Darstellungen aus islamischem Herrschaftsgebiet wie die obige aufzutreiben, muss man schon im nordindichen Moghul-Reich suchen; wo eine kleine islamische Oberschicht mongolischer Herkunft über ein große Masse hinduistischer Untertanen gebot - und dabei zweckmäßigerweise eine lieberale Auslegung des Koran vertraten. Ob Manohar, der Maler der obigen Miniatur, selbst Moslem oder Hindu war, konnte ich nicht herausfinden.
JE
Vorurteile gegen den Islam?
Der Islamwissenschafter Ulrich Rudolph plädiert für Sachlichkeit
Schluss mit den Vorurteilen!
Ist
der Islam eine seit Jahrhunderten geistig stagnierende religiöse
Kultur? Zeigt sich im Islamismus und in der Gewalt islamistischer
Terroristen das, was den Islam von jeher und «eigentlich» ausmacht? –
Der Islamwissenschafter Ulrich Rudolph plädiert gegen Pauschalurteile
und für Sachlichkeit. Seit kurzem wird in der NZZ eine Debatte über den Islam geführt, die von Martin Rhonheimers Artikel «Töten im Namen Allahs» angestossen wurde. Darin behauptet der Autor unter Verweis auf mehrere Koranverse, Gewalt gegen Ungläubige gehöre zum Wesen des Islams, während das Christentum Gewalttaten nur als Fehldeutung der ursprünglichen Botschaft kenne. Necla Kelek stimmt dieser Behauptung ausdrücklich zu, setzt in ihrem Beitrag «Eine Religion der Beliebigkeit» aber andere Akzente. Sie geht davon aus, dass der Koran ein «Textbaukasten» ohne inhaltliche Verbindlichkeit sei. Daher sei es im Islam auch nicht wie im Christentum zu einer vernunftgeleiteten Verständigung über die Glaubensinhalte gekommen. Entstanden sei vielmehr eine «Herrschaft der Vorbeter, die seit tausend Jahren einen innerislamischen Diskurs verhindern», was zur Unterdrückung der Vernunft und zur fraglosen Unterwerfung unter die ewiggleichen Doktrinen und Verhaltensnormen geführt habe.
Ein Geschichtsbild
Die Debatte hat inzwischen eine breite Resonanz gefunden, die bereits zu einer kontroversen Diskussion über Rhonheimers Interpretation von Koranversen führte. Gleichwohl erscheint es angezeigt, jenseits des Streits über einzelne Verse einige grundsätzliche Punkte anzusprechen. Denn hinter den vorgetragenen Argumenten stehen Grundannahmen über den Islam, die aufgedeckt werden müssen, weil sie höchst problematisch sind und den Diskurs mit und unter den Muslimen – der durchaus geführt werden muss – nicht fördern, sondern konterkarieren.
Das beginnt mit dem Geschichtsbild, das in der Debatte von einigen vorausgesetzt wird und von Kelek offengelegt wird: In der Entwicklung der islamischen Welt sei es nach einer kurzen Blüte von Wissenschaft und Philosophie zu einem intellektuellen Stillstand gekommen; er dauere nun schon viele Jahrhunderte an und habe seither die Entwicklung von Rationalität und vernunftgeleiteter Lebensbewältigung verhindert. Dieses Geschichtsbild ist nicht neu. Es entstand bereits im frühen 19. Jahrhundert. Damals konstruierte die europäische Orientalistik in einer Verbindung aus kolonialem Überlegenheitsgefühl und beschränkter Quellenkenntnis einen Orient, dem es angeblich an geistiger Autonomie mangele. Am deutlichsten wird das am Beispiel der Philosophie.
Man kannte einige islamische Autoren wie Avicenna und Averroes, weil sie im lateinischen Mittelalter rezipiert wurden; also gestand man den Muslimen zu, dass ihre Philosophie in der Frühzeit, als diese Autoren lebten, geblüht habe. Mit Averroes endete indes die lateinische Rezeption, und damit erlosch auch das Interesse der europäischen Wissenschaft. So kam es zu der folgenschweren These, die Philosophie und überhaupt der rationale Diskurs hätten in der islamischen Welt nach 1200 aufgehört zu existieren. Sie ist inzwischen unzählige Male wiederholt worden, aber das macht sie nicht plausibler.
Wir wissen mittlerweile, dass die Philosophie im Islam vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart andauerte. Sie ist sogar zu einem Schwerpunkt islamwissenschaftlicher Forschung geworden. Dabei hat sich gezeigt, dass der philosophische Diskurs nach 1200 nicht nur fortgesetzt wurde, sondern auch auf die Theologie und bestimmte mystische Strömungen, die für die gelebte Religion sehr wichtig waren, ausstrahlte. Das wurde erst kürzlich auf einer Tagung zum Thema «Philosophical Theology in Islam» an der Londoner School of Oriental and African Studies eindrücklich bestätigt.
Das überkommene Bild von der geistigen Stagnation der Muslime wird also gerade von der Forschung revidiert, und solche Ergebnisse sollte man zur Kenntnis nehmen, wenn man eine sachliche Diskussion über den Islam und dessen intellektuelle Entwicklung anstrebt.
Eine zweite, in der Debatte geltend gemachte Annahme lautet, dass heutige Islamisten, zumal, wenn sie gewaltbereit seien, zu den Wurzeln des Islams zurückkehrten. Das entspricht genau dem Bild, das Islamisten gerne von sich selbst zeichnen, sollte aber nicht unbesehen übernommen, sondern kritisch hinterfragt werden. Tatsächlich weist der islamistische Diskurs nämlich zahlreiche Parallelen zu anderen zeitgenössischen Ideologien auf. Das beginnt damit, dass er die traditionelle islamische Bildung ablehnt und auf verkürzte Lösungen setzt. Dabei spielt die alte Idee einer idealen Frühzeit des Islams natürlich eine grosse Rolle. Sie wird aber völlig umgedeutet. In ihrem Mittelpunkt stehen nun nicht mehr die Jenseitsorientierung und die Idee, die frühe Gemeinde habe durch den persönlichen Kontakt mit Mohammed an dessen Nähe zu Gott und zur Offenbarung teilnehmen können. Die Erwartungshaltung wird vielmehr vom Jenseits auf das Diesseits umgelenkt, denn aus dem theologischen ist ein politisches Heilsversprechen geworden. Es besagt, dass mit der Rückkehr zum «reinen» Islam schon hier und jetzt eine vollkommene «islamische Ordnung» entstehen könne, die alle Bereiche des Lebens regele und eine ideale, allen anderen überlegene Gemeinschaft formen werde.
Damit wurde der Schritt von der Religion zur Ideologie vollzogen, aber das geschah nicht ohne Widerspruch. Es gibt längst eine innerislamische Kritik am Islamismus, und es gibt zahlreiche Versuche, offenere Modelle eines islamischen Selbstverständnisses zu entwickeln. Für Ersteres steht etwa der Ägypter al-Ashmawi, der in seinem 1987 erschienenen Buch «Der politische Islam» das islamistische Gedankengut scharf verurteilte. An der Universität Ankara – das wäre ein Beispiel für Letzteres – sind in den letzten Jahrzehnten neue, der Hermeneutik verpflichtete kritische Methoden der Koranexegese ausgearbeitet worden. – Solche Stimmen sollte man unterstützen, sowohl in der islamischen Welt als auch in Europa, wo sich gerade ein differenzierter öffentlicher Diskurs über solche Fragen entwickelt, wie etwa die grosse Tagung «Horizonte der islamischen Theologie» an der Universität Frankfurt Anfang September gezeigt hat. Aber das tut man nicht, indem man jede Form von neuer und subtiler Hermeneutik als «Islam light» diffamiert und radikale Positionen als den «eigentlichen» Islam bezeichnet – was nur Fundamentalisten in die Hände spielt.
Die Gewaltfrage
Das führt schliesslich zu einem dritten Punkt, nämlich zur Frage nach der Gewalt. Sie muss natürlich gestellt werden, aber das sollte auf angemessene Weise geschehen. Der Islamismus ist ein Phänomen des 20. Jahrhunderts, der Islamische Staat (IS) gar des 21. Jahrhunderts, und dem sollte eine Analyse auch Rechnung tragen. Dabei spielt die Religion selbstverständlich eine Rolle, aber nicht im Sinne des Aufrechnens einzelner Bibelzitate und Koranverse. Das entspricht eher mittelalterlicher Polemik und bringt letztlich nur Religion insgesamt in Misskredit – so ist in einem Leserbrief zur Debatte ja auch schon die Überwindung aller Religionen gefordert worden. Dabei gerät allerdings der positive Beitrag, den Religionen zur Grundlegung von Gesellschaften leisten, völlig aus dem Blickfeld. Er existiert jedoch, denn jede Gesellschaft, auch die demokratische, baut auf ethischen Grundlagen auf, die unter anderem von religiösen Überzeugungen gelegt wurden.
Gleichwohl bleibt die Frage nach der Gewalt. Doch sie lautet nicht, ob Religionen ein Gewaltpotenzial besitzen – das ist gewiss der Fall. Die Frage lautet vielmehr: Wann und unter welchen Umständen wird dieses Potenzial aktiviert? Auf den Islam bezogen, heisst dies, zu überlegen, warum es seit dem ausgehenden 20. Jahrhundert zu zahlreichen Gewalttaten kam, was für vorangehende Jahrhunderte, in denen islamische Staaten wie das Osmanische Reich sehr viel mächtiger und damit gewaltfähiger waren, eben so nicht gilt. Die Antwort kann nicht eindimensional sein. Schon erste Untersuchungen darüber, warum sich junge Muslime heute dem IS anschliessen, haben gezeigt, dass es selbst auf diese begrenzte Fragestellung mehrere Perspektiven gibt.
Man wird also damit rechnen müssen, dass neben religiösen und ideologischen Aspekten anderen Faktoren eine grosse Bedeutung zukommt. Dazu gehören politische Konstellationen (wie die autoritären Regime in islamischen Ländern und noch immer die Folgen von Kolonisation und Dekolonisierung), soziale Probleme (Spaltung der Gesellschaften, Ungerechtigkeit), Fragen der Psychologie und der Bildung bzw. des Bildungsmangels. Hinzu kommen Phänomene, die sehr stark an frühere Dritte-Welt-Ideologien und den emotional aufgeladenen «Befreiungskampf» gegen «Imperialisten» erinnern. Ausserdem muss man damit rechnen, dass die beginnende Zerstörung nahöstlicher Gesellschaften eine Eigendynamik entwickelt. Der indische Essayist Pankaj Mishra hat kürzlich den IS mit den atheistischen Roten Khmer verglichen. Auch das ist zunächst nur eine Hypothese, die aber sicher eine genauere Überprüfung verdient.
All das soll nicht von den Fragen der Religion ablenken. Im Gegenteil: Es soll sie erweitern und kontextualisieren. Denn man wird die Gewaltphänomene, die uns zu Recht beunruhigen, letztlich nur erklären und angemessen beantworten können, wenn man sie sachlich und in ihrer Gesamtheit analysiert.
Nota
- "Es gibt zahlreiche Versuche..." Wer hat das bestritten? Das Argumente von Ronheimer und Frau Kelek ist aber, dass sie erfolglos bleiben werden, weil sie sich auf keinem verbindlichen gemeinsamen Glaubenskern berufen können, dem auch und gerade die Fudamentalisten sich 'unterwerfen' ("Islam heißt...") müssten. Eine Religion der Beliebigkeit, schreibt Frau Kelek. Ach, so ganz beliebig scheint sie ja doch nicht zu sein: Was momentan politisch opportun ist, fällt offenbar schwer ins Gewicht.
- "Wir wissen mittlerweile, dass die Philosophie im Islam vom 13. Jahrhundert bis zur Gegenwart andauerte." Dass sie andauerte, wird auch keiner bestritten haben. Dass sie fruchtbar, nämlich der Ausseinandersetzung wert war, wird bezweifelt. Avicenna, Averroes, aber auch Maimonides haben die christliche Hochscholastik geprägt - nicht, weil die islamische Kultur sich nach Westen, sondern der Westen sich zum Orient hingewendet hat; zuerst im Kreuzzug, das ist wahr, aber dann in der Gelehrsamkeit. Der Westen hat sich geöffnet, um zu empfangen, aber nicht weil Averrroes und Avicenna islamische Philosophen gewesen wären, sondern weil sie gerade das nicht waren: Averroes gilt bis heute als Begründer der Lehre von den "zwei Wahrheiten". Und Maimonides war Jude.
Bereits Averroes ist freilich im Reich des Islam ziemlich wirkungslos geblieben. Und Prof. Rudolph müsste uns nicht nur zeigen, dass auch nach 1300 im Islam 'weiter philosophiert wurde', sondern dass das auf die islamische Kultur irgendeinen Einfluss gehabt hat. Und soll er nicht antworten, auch die Abendländer seien nicht alle Philosophen geworden! Philosophie hat die politisch-kulturelle Epoche der Aufklärung geprägt, und dass die den europäischen Alltag (mit Synkopen) bis heute prägt, wird er nicht bestreiten können.
Das war der Kern von Ronheimers und Frau Keleks Argument. Es kommt mir nach Prof. Rudolphs Beitrag und dem, was er weglässt, noch etwas plausibler vor.
JE
Die ursprüngliche Vieldeutigkeit des Islam.

aus Die Presse, Wien, 17. 7. 2014
Salzburger Festspiele:
Allah ist vieldeutig, Allah sei Dank
Sehr
„ambiguitätstolerant“ sei die klassische islamische Kultur im Gegensatz
zum Islamismus gewesen, sagt der deutsche Arabist Thomas Bauer, der am
Freitag in Salzburg auftritt.
Die Presse: Das Wort Ambiguitätstoleranz kommt aus der Psychologie: Es gibt Leute, die Mehrdeutigkeiten, Widersprüche besser als andere aushalten. Wendet man das auf Gesellschaften an, fallen einem als Erstes nicht unbedingt islamische Länder ein. Früher war das anders, meinen Sie?
Thomas Bauer: Ja, Widersprüche à la „Einerseits mag ich Musik, andererseits gibt es einen Hadith, der das verbietet“ spielten im Islam in klassischer Zeit nicht so eine Rolle. Er ruhte stärker in sich, man musste sich nicht so sehr gegenüber anderen definieren, abgrenzen. Sogar rechthaberischsten Gelehrten war klar, dass ihre Meinung nur wahrscheinlich die richtige war, nicht sicher.
Der Koran als geoffenbartes Gotteswort wird gern für die angebliche Starre des Islam verantwortlich gemacht. Wie mehrdeutig ist Allahs Wort?
Über tausende Jahre ist die Auslegungskultur davon ausgegangen, dass der Koran unendlich viele Bedeutungen hat. Ob der Ursprungstext geoffenbart ist oder nicht, spielt da die kleinste Rolle. Dass der Koran als Gotteswort Ambiguität nicht verhindert, sehen Sie an jedem klassischen Korankommentar, der mehrere Deutungen nebeneinander anführt. Diesen Auslegungsspielraum haben die Juristen auch genutzt. Das Wort Gottesstaat stammt von Augustinus, das gibt es im Arabischen gar nicht. Man wollte Rechtssicherheit, dafür sorgten die Rechtsgelehrten, und diese hatten zwar göttliche Quellen, aber was sie daraus machten, war wieder eine ganz andere Sache. Gerade im Strafrecht spielen religiöse Texte so gut wie keine Rolle. Und wenn doch einmal, wie im 17. Jahrhundert, hatte das politische Hintergründe.
Wissenschaft konnte sich in der islamischen Kultur nicht weiterentwickeln. Was hat das für Sie mit Religion zu tun?
Die einst blühenden Wissenschaften seien durch engstirnige Religionsgelehrte verkümmert – da wirkt das Aufklärungsdenken, dass die Priester Volksverdummer sind. Für den Islam stimmt das nicht, es hat dort kaum Gelehrte gegeben, die gegen die Wissenschaft gekämpft haben. In diesem Punkt hat sich auch die Islamwissenschaft lange Zeit irreführen lassen. Heute weiß man, dass der Grund dafür strukturelle Entwicklungen* sind, die erst viel später eingesetzt haben.
In allen möglichen Bereichen wie Musik oder Sexualität gab es oft ein geduldetes Neben- und Durcheinander unterschiedlicher Werte und Regeln. Diese Inkonsequenz in der Alltagskultur findet man im christlichen Abendland genauso. Interessant finde ich vor allem, wie sehr die Freude an der Ambiguität in der Wissenschaft von den Lesarten des Korans und im Nachdenken über Sprache dominierte...
Das Erstaunlichste an der Lesartenlehre ist nicht, dass es die unterschiedlichen Lesarten gibt, sondern die Freude und Begeisterung, mit der diese Mehrdeutigkeit als göttliche Gnade begrüßt wurde! Auch die arabische Rhetoriktheorie hatte enorme Freude am Uneindeutigen. Es gab immer wieder Strömungen, die von der Interpretationsvielfalt weg und den Text wörtlich lesen wollten; sie setzten sich aber höchstens kurzzeitig durch. Heute geht diese Lesartentradition allerdings etwas unter, die Islamisten ersetzen sie durch Ideologien, die unzweideutig nach westlichem Ideologiemuster funktionieren.
Sie meinen tatsächlich, der Islamismus hat sich die „Ambiguitätsintoleranz“ vom Westen abgeschaut?
Das 19. Jahrhundert ist im Westen eine Zeit, in der man Widersprüche als quälend empfindet und in der sich Ideologien bilden. Genau in dieser Zeit stellt sich auch für die islamische Welt die Alternative, westliche Ideologien zu übernehmen oder sich mit einer eigenen Ideologie dagegen zu behaupten.
Kämpfe um den „wahren“ Islam gab es aber immer schon. Wie passt der alte Konflikt zwischen Sunniten und Schiiten zur islamischen Ambiguitätstoleranz?
In der Frühzeit gab es große Spannungen, aber Sunniten und Schiiten waren in der Geschichte nicht ein großer Gegensatz, sie waren auch nie homogene Gruppen. Rivalitäten gab es immer, aber mit den heutigen sind sie nicht vergleichbar. Die meiste Zeit war das Zusammenleben friedlich, auch im Irak bis ganz zuletzt – der Stamm war dort wichtiger als die Frage, ob man Sunnit oder Schiit ist. Das sind moderne Fronten. Auch die jetzige Solidarität zwischen Assads Alewiten und den Zwölfer-Schiiten in Syrien verdankt sich modernen Verhältnissen.
Die Terrorgruppe Isis beruft sich auf das Kalifat...
Isis macht aus dem Islam, was Pol Pot aus Karl Marx gemacht hat. Das fängt schon damit an, dass man Kirchen zerstört, was man nach dem klassischen Islam nicht darf. Als der Islamismus mit den Wahhabiten in Saudiarabien das erste Mal schlagend wurde – damals noch ohne westlichen Einfluss –, da waren die Hauptgegner traditionelle Muslime. Sie empfanden es als unislamisch, dass man sagte, jemand sei kein Muslim mehr, weil er das und das anders sehe.
Sie sprechen in Salzburg über Einflüsse der islamischen Kultur auf die europäische Dichtung seit dem Mittelalter. Goethe oder Rückert waren fasziniert vom Islam. Wann kam der große Umschwung im westlichen Islambild?
Viel später, als man glaubt. Die iranische Revolution 1979 war ein Wendepunkt, als sich zum ersten Mal ein größerer islamischer Staat nicht in die vom Ost-West-Konflikt geprägte Nachkriegswelt einfügen wollte. Dramatisch wurde es, als der „Ostblock“ zusammenbrach. Man brauchte einen Ersatzfeind.
ISLAM-DISKUSSION IN SALZBURG
Thomas Bauer, geboren 1961 in Nürnberg, ist Arabist und Islamwissenschaftler an der Universität Münster. In Salzburg ist er Gast bei der Auftaktveranstaltung zur „Ouverture spirituelle“ der Festspiele am 18.Juli 2014. Thema der Vorträge und Diskussion: „Der Islam im europäischen Gedächtnis“.
*Nota.
Herr Bauer, das hätte ich gern genauer erfahren.
JE
Der Islam war nicht immer nur eine Gesetzesreligion.
«Den» Islam gibt es nicht
Muslime kennen viele Wege zur geistigen Erneuerung
Der
Mainstream-Islam ist heute ein Diktat der Politik. Dabei werden Muslime
als Opfer fremder Mächte dargestellt – eine Sicht, die sich viele
muslimische Communitys längst zu eigen gemacht haben. Das muss sich
ändern.
Islamexperten
haben sich lange darum bemüht, Nichtmuslimen zu erklären, dass es «den»
Islam nicht gibt. Viel wichtiger indes wäre es, unter Muslimen selbst
diesen Gedanken stärker zu verankern. Islam ist nicht gleich Islam, und
wer von der eigenen Vorstellung und Praxis abweicht, ist nicht gleich
ein schlechterer Muslim. Den einen «wahren» Islam mag es aus einer
göttlichen Perspektive geben, aber kein Mensch kann sich anmassen, ihn
ebenfalls zu kennen. Das beanspruchen nur Fundamentalisten, dünkelhafte
Gelehrte und blasierte Imame für sich.
Anfällig
für deren Avancen ist man vor allem dann, wenn man einen Leitfaden fürs
eigene Leben sucht – mit klaren Anweisungen. Man läuft vermeintlich
weisen Männern hinterher in der Hoffnung, die eigene Verantwortung im
Zweifelsfall auf sie abwälzen zu können. «Gehorchen ist leichter als
befehlen», wusste schon Friedrich Maximilian Klinger.
Viele Versionen des Islams
Sich
von vertrauten Gewissheiten aus der Kindheit abzunabeln, bedeutet
Abschied von Bequemlichkeit und Akzeptanz von Ungewissheit. Der Islam
ist eine anspruchsvolle Religion, die entgegen landläufigen
Vorstellungen keine einfachen Antworten liefert.
Weder
der Koran ist eindeutig noch die Erkenntnisse über das Leben des
Propheten Mohammed. Unzählige Schriften aus 1400 Jahren Islam zeugen
davon. Somit ist der Koran an sich ebenso wenig wie Mohammed das Problem
– das Problem ist der Anspruch einiger «auserwählter» Menschen, die
glauben, die islamischen Quellen allein wahrheitsgemäss auslegen zu
können.
Mangels
allgemeiner oberster Autorität gibt es in der islamischen Geschichte
bereits seit dem Ableben Mohammeds divergierende Auffassungen von der
«wahren» Religion. Inzwischen gilt der Islam vielen als
«Gesetzreligion», in der es primär um das Einhalten von Geboten und
Verboten geht. Doch das ist nur ein Verständnis vom Islam, das sich
insbesondere in den vergangenen 150 Jahren vielerorts durchgesetzt hat.
Es
wird zumeist von solchen propagiert, die Machtinteressen mit
Glaubensfragen verknüpfen; weshalb Islamisten oft zugleich
Fundamentalisten sind. Der Mainstream-Islam ist heute vor allem ein
Diktat der Politik. Überall auf der Welt spielen politische Interessen
in die gelebte Religion hinein.
Am
deutlichsten wird das in dem Versuch, den Niedergang der glorreichen
alten Welt im Kampf mit dem Westen wieder wettzumachen. Die Losung der
Islamisten, wonach der Islam die Lösung aller Probleme sei, prägt seit
Generationen das Denken zu vieler Musliminnen und Muslime – vor allem
dort, wo es ihnen im Alltag nicht so gut geht, also in etwa 90 Prozent
der islamischen Welt.
Viele
von ihnen fliehen vor diesen Zuständen in den Westen, wo sie sich trotz
vielfachen Dissonanzen Freiheit und Wohlstand erhoffen, und bringen
ihre religiösen Prägungen mit. Sofern noch nicht geschehen, müssen sich
Muslime unbedingt davon befreien, Religion von Politik reinigen und den
Zwang abstreifen, sich permanent als Opfer böser fremder Weltmächte zu
fühlen, die angeblich «den» Islam schwächen und «die» Muslime
kleinhalten wollten.
Schuld sind nicht die anderen
Auch
dieses islamistische Narrativ ist inzwischen tief in die muslimische
Community weltweit eingesickert – mit dem Ergebnis: Die Schuld wird
zuerst bei anderen gesucht. Um Teil der Religion des Islams sein zu
können, bedarf es eines hohen Masses an Toleranz für andere Positionen.
In der Vergangenheit hatten gläubige Muslime das vergleichsweise gut
eingeübt. Daran sollten sie anknüpfen und wieder mehr Selbstbewusstsein
im Umgang mit dem Koran, dem Leben des Propheten Mohammed und dem
Gelehrtenwissen aufbringen. Dazu bedarf es Mündigkeit, Emanzipation,
Vernunft.
Damit sind
die Schlagworte, die aufs Zeitalter der Aufklärung in Europa hinweisen,
gefallen. Dennoch ist «Aufklärung» hier der falsche Begriff, weil er
falsche Assoziationen weckt. Hört auf, den Islam und andere Religionen
durch die christliche Brille zu betrachten!
Die
Entwicklung der muslimischen Gemeinschaft ist eine andere als die der
katholischen Kirche. Hier versuchte eine Macht, der Vatikan im Pakt mit
weltlichen Führern, die Gläubigen zu beherrschen. Dort scheiterte ein
vergleichbarer Anspruch spätestens während der Abbasiden-Dynastie, weil
der Kalif zunehmend zum Grüssaugust degradiert wurde.
Im
Islam gibt es stattdessen einzelne Gruppierungen, konfessionelle
Abspaltungen, theologische Schulen, Rechtsschulen, Sekten, die mehr oder
weniger Dominanz für sich beanspruchen. Hinzu kommen vielfältige
kulturelle Unterschiede, die die Religionsvorstellungen zwischen
Hindukusch und Andalusien geprägt haben. In Indien etwa arrangierten
sich Muslime ungeachtet anderslautender Koranverse mit den sogenannten
«Götzendienern», während Muslime auf der Arabischen Halbinsel bis heute
eher eine radikale Ablehnung gegen sie predigen.
Solche
grundlegenden Differenzen verhindern es, die europäische Aufklärung
eins zu eins auf andere Kulturräume zu übertragen. Um das hervorzuheben,
habe ich schon des Öfteren betont: «Der» Islam braucht keine Aufklärung
im europäischen Sinn, aber Muslime müssen wieder Herr und Herrin über
ihre Vernunft werden und ihren Verstand in religiösen Fragen einsetzen.
Das
wäre keine Neuerung, dafür gibt es vielfältige Anknüpfungspunkte in der
Geschichte – etwa in Gestalt der Philosophen Alpharabius alias Abu Nasr
al-Farabi (gestorben 950) oder Averroes alias Ibn Ruschd (gest. 1198),
des religionskritischen Arztes und Freidenkers Rhazes alias Abu Bakr
al-Razi (gest. 925), des Korankommen- tators Fakhr al-Din al-Razi (gest.
1210), des Dichters al-Ma’arri (gest. 1057) – ein Skeptizist, der heute
als religions- bzw. islamfeindlich verfemt würde – oder in Gestalt
späterer Persönlichkeiten wie des islamischen Humanisten Murtada
al-Zabidi (gest. 1791) oder des ägyptischen
Beinah-Literaturnobelpreisträgers Taha Husain (gest. 1973).
Selbst
der Koran wird von Muslimen an verschiedenen Stellen so verstanden,
dass er Rationalität von den Menschen einfordert: «Und er lässt (seinen)
Zorn auf jene herab, die ihre Vernunft (dazu) nicht gebrauchen wollen.»
(Sure 10, Vers 100) Oder: «Wahrlich, darin liegen Zeichen für die
Leute, die Verstand haben.» (16, 12)
Lamya Kaddor ist Islamwissenschafterin und Publizistin.
Nota. - Der Islam steht wegen seiner theologischen Vieldeutigkeit - oder Leere, wie man's nimmt - vor dem Dilemma, 'mit sich identisch sein' zu können nur entweder als strikte Gesetzeslehre oder als eine Religion der reinen Innerlichkeit.
Als Gesetzeslehre kann er sich nicht 'aus der Politik lösen', er wird von der Politik beherrscht sein und die Po- litik beherrschen wollen - einen andern Inhalt hätte er dann ja nicht. Als Religion der Innerlichkeit wird er sich als Lehre (die er eo ipso gar nicht zu sein beanspruchen könnte) mit der Politik nicht einlassen. Dass der einzel- ne Muslim in der Welt wirksam wird, ist ja dabei nicht ausgeschlossen. Mystisch bewegte Gläubige haben, wie die höchstverschiedenen Meister Eckhart und der Emir Abd el-Kader, den Weg in die Öffentlichkeit gesucht und gefunden; auf seine Art auch al-Halladsch, der Vater der islamischen Mystik.
Allerdings neigen mystische Bewegungen dazu, einen Messias hervorzubringen, wie den Juden Sabbatai Zvi oder den sudanesischen Mahdi, dessen Bewegung nicht nur ein Aufstand gegen die britischen Fremdherrscher war, sondern auch eine sehr blutige fundamentalisische Gewaltorgie. Das ist das Eigentümliche mystischer Be- geisterung, dass sie keinen Lehrern folgt, sondern unberechenbaren Propheten. Eine rein innerliche Frömmig- keit hingegen wird den zeitgenössischn fanatischen Gestzeshütern wenig entgegensetzen können, nämlich nicht auf deren Terrain, der Öffentlichkeit.
JE
Der Islam gehört nicht zu Deutschland.
Nicht nur die christliche Religion, sondern auch die christlichen Kirchen haben die abendländische Kultur geprägt; und dies lange bevor wir demokratisch, republikanisch,* laizistisch und liberal geworden sind.
Wir sind demokratisch, republikanisch, laizistisch und liberal geworden, und den Einfluss der Kirchen aufs öffent- liche Leben und das Lasten der Dogmen auf den Intelligenzen haben wir zurückgedrängt, soweit es geht, und eines Tages werden auch in Bayern die Kruzifixe aus den Klassenzimmern verschwunden sein.
Die Kirchensteuer könnten wir auch noch abschaffen, aber die Dome in Köln, Speyer und Limburg müssten wir doch aus Mitteln des Gemeinwesens unterhalten (und möglichst als Kirchen), weil sie zum Bestand unserer Kultur gehören, so wie die Weihnachts- und Osterfeiertage auch - und noch einiges mehr, worüber man im einzelnen durchaus streiten kann.
Es leben einige Millionen Muslime in Deutschland, und so, wie Deutschland nun einmal geworden ist, gehören sie dazu. Der Islam gehört nicht zu Deutschland. Religion ist Privatsache. Dass wir unsere christliche Herkunft nicht einfach abstreifen können - ich meine: auch in der Öffentlichkeit nicht - wie ein Hemd, ist grad genug. Für irgend- welche Importe ist kein Platz. Was in deutschen Satiremagazinen stehen darf und was nicht, regeln deutsche Gesetze und keine Fatwas.
*) In Deutschland waren die Landesfürsten bis zur Revolution von 1918 zugleich die obersten Bischöfe der lutherischen Landeskirchen.
am 7. Januar unter der Überschrift Je suis Charlie.
Dienstag, 13. Januar 2015
Was ist Sufismus?
Warum der Sufismus gar nicht so friedlich ist
Die Glaubensrichtung ist für viele Anhänger im Westen der liberalere Islam. Das ist ein Missverständnis.
Gastbeitrag von Stefan Weidner
Vom Anfang des 18. bis weit ins 20. Jahrhundert genoss die islamische Kultur einen ansehnlichen Ruf. Davon ist kaum etwas übrig geblieben. Allein der Sufismus, also die islamische Mystik, scheint noch davon zu zehren. Bereits Goethe hatte den mystischen Aspekt des Islam positiv hervorgehoben. Während der österreichische Orientalist Joseph von Hammer-Purgstall den persischen Klassiker Hafis als weinseligen Liebesdichter übersetzte, erkannte Goethe in Hafis die "mystische Zunge".
Vom Pantheismus Spinozas geprägt, fand Goethe leichten Zugang zum Wechselspiel von Spiritualität und Weltlichkeit, das Hafis zur Meisterschaft entwickelt hatte. Seither gilt im Westen die liebestrunkene islamische Mystik als positives Gegenbild zu Orthodoxie und religiöser Engstirnigkeit.
Dieses nicht falsche, aber einseitige Bild hat sich bis in die Gegenwart gehalten und in die islamische Welt zurückgewirkt. Die Bewegung des türkischen Predigers Fethullah Gülen verweist gern auf ihre Anleihen beim Sufismus, was ihre ansonsten eher orthodoxe religiöse Orientierung gut kaschiert. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan macht Gülen für den Putschversuch vor einigen Wochen verantwortlich und verfolgt echte und vermeintliche Anhänger unnachsichtig. Früher aber waren beide Weggefährten. Zusammen mit Erdoğan soll Gülen eine Zeit lang den im türkischsprachigen Teil Zyperns wirkenden Sufi-Meister des Naqschbandia-Ordens, Scheich Nazim, frequentiert haben. Scheich Nazim, so wird kolportiert, habe Erdoğans neuosmanische Visionen jedoch nicht teilen wollen, sodass sich ihre Wege bald trennten.
Ein Sufi-Orden ist kein Mönchsorden. Eher schon eine politische Partei.
Man sieht an diesem Beispiel, dass Sufismus mehr
und meist Anderes ist, als das, was man im christlichen Bereich unter
"Mystik" versteht. Ein Sufi-Orden ist keine sich von der Welt
abschließende Gemeinschaft wie ein christlicher Mönchsorden. Eher ähnelt
die Mitgliedschaft darin der in einem Sportverein oder einer
politischen Partei, nur eben mit religiöser Ausrichtung. Was viele
Menschen im Westen daran anzieht, ist nicht zuletzt das erwähnte
spirituelle Gemeinschaftserlebnis im Zikir, welches einmal in der Woche
die Adepten aus ihrem Alltag hebt.
Indem die Sufi-Orden ihre Mitglieder einbinden und spirituell betreuen, kommt ihnen eine wichtige gesellschaftspolitische Funktion zu. Man dächte, sie wären die idealen Orte, um die psychisch instabilen, islamisch indoktrinierten Menschen aufzufangen, die für die Terrorpropaganda des sogenannten Islamischen Staates empfänglich scheinen. Doch leider schwindet in der islamischen Welt die Anziehungskraft des Sufismus, während der mit saudischem Geld finanzierte Salafismus zunehmend auch die spirituelle Führerschaft beansprucht.
In Algerien und Libyen kämpften die Sufi-Orden gegen die Kolonialmächte
Handke, Trojanow, Kermani - viele Autoren liebäugeln mit der islamischen Mystik
Findet hier noch ein echter Dialog mit der mystischen Tradition statt?
Säkularisierung der islamischen Welt?
Olivier Roy über den Säkularismus
Religion auf dem Rückzug
In muslimischen Ländern scheinen religiöse Extremisten die Szene zunehmend zu dominieren. Der Islam-Experte Olivier Roy konstatiert dennoch auch dort eine Ausdifferenzierung der Glaubenslandschaft.
von Olivier Roy
Wir Europäer leben in säkularen – und nicht in prä- oder postsäkularen – Gesellschaften. Weltweit hat sich die Säkularisierung durchgesetzt, sogar in muslimischen Ländern. In einer Zeit, da wir vom Aufstieg des «Islamischen Staats» in Atem gehalten werden, mag diese Behauptung paradox klingen: Um sie zu erklären, muss der Wandel im Verhältnis zwischen Kultur und Religion und insbesondere die «Dekulturierung» der Religion beleuchtet werden.
Was ist Säkularisierung?
Es gibt ganz unterschiedliche Arten, Säkularisierung zu definieren. Als soziales Phänomen ist sie nicht ein abstrakter Prozess; es geht immer um die Säkularisierung einer bestimmten Religion, deren Natur sich im Verlauf der Säkularisierung wandelt. Gängige Definitionen der Säkularisierung umfassen in der Regel drei Elemente: erstens die Trennung von Staat und Religion, von Politik und Konfession, die aber nicht notwendigerweise auch eine Säkularisierung der Gesellschaft zur Folge hat. Amerika ist hiefür ein gutes Beispiel: Obwohl Kirche und Staat klar getrennt sind, ist ein grosser Teil der Bevölkerung immer noch religiös.
Das zweite Element ist der schwindende Einfluss religiöser Institutionen auf die Gesellschaft. Aufgaben wie Bildung oder Gesundheitswesen sind in die Hände des Staats oder des Privatsektors übergegangen; in Europa haben sich die Kirchen aus dem «Management» der Gesellschaft weitestgehend zurückgezogen. Das dritte Element der Säkularisierung schliesslich ist das, was Max Weber «Entzauberung der Welt» genannt hat . Auch dieser Prozess muss nicht bedeuten, dass die Menschen zu Atheisten werden; aber die Bedeutung der Religion in unserem Leben und Alltag nimmt ab, noch wenn wir uns weiterhin als Glied einer religiösen Gemeinschaft definieren. In dieser Hinsicht bedeutet Säkularisierung eher eine Marginalisierung denn eine Exklusion der Religion.
Hinsichtlich der Trennung von Politik und Religion sind heute alle Staaten säkular, sogar die Theokratien. Eine «säkulare Theokratie» tönt zwar wie eine «contradictio in adiecto», aber hier muss hervorgehoben werden, dass ein säkularer Staat sich dadurch auszeichnet, dass der Staat die Religion definiert und nicht umgekehrt. In der Islamischen Republik Iran, einer der wenigen verbliebenen Theokratien, ist das Amt der höchsten Instanz im Staat, des Obersten Rechtsgelehrten, politisch definiert; kein Vorbild dafür lässt sich in der Geschichte des Islams finden. Der Oberste Rechtsgelehrte wird mittels eines komplexen, verfassungsmässig festgelegten Prozesses gewählt und nicht, weil er die höchste religiöse Autorität ist.
Am Beispiel Irans werden die Widersprüche offensichtlich, denen ein religiöses Staatswesen per se unterworfen ist. Die Gesetzgebung fusst auf der Religion, die oberste Autorität ist Gott. Nur: Gott spricht nicht. Wenn er die letzte Instanz ist, wer kann dann wissen, was er sagt? Und was genau ist religiöses Gesetz? Das iranische Parlament darf kein Gesetz erlassen, das mit dem Islam nicht in Einklang steht. Der Oberste Wächterrat wiederum kann zwar ein Gesetz mit dem Argument ablehnen, dass es nicht mit der Scharia konform sei; aber er hat selbst keine gesetzgebende Funktion. Was also, wenn das Parlament ein Gesetz durchwinkt und der Wächterrat es ablehnt? Zu diesem Behuf wurde ein Schlichtungsrat ins Leben gerufen, der in solchen Fällen vermitteln soll – und wie definiert sich dieser? Es ist eine politische Institution, in der alle machthabenden Instanzen vertreten sind. Anders kann es gar nicht sein.
In allen Staaten, die sich auf eine islamische Verfassung berufen oder die gar keine Verfassung haben, weil derlei im Islam nicht existiert, ist die letzte Instanz der Macht politisch. So liegt in Saudiarabien, einem islamischen Staat ohne Verfassung, die höchste Entscheidungsmacht beim König – obwohl der Koran das Königtum nicht kennt und dieses Amt keine religiöse Autorität impliziert. In Afghanistan legten die Taliban die Macht in die Hände der islamischen Richter und erklärten die Scharia zum Staatsrecht; eine Verfassung oder ein Oberstes Gericht hielten sie für unnötig und beschlossen, dass jeder Richter die Scharia direkt anwenden solle. Natürlich funktionierte das nicht, da jeder Richter seine eigene Auffassung der islamischen Rechtslehre einbrachte. Am Ende traf der politische Führer, Mullah Omar, als selbsternannter «Führer der Gläubigen» die Entscheidungen.
Es ist nur eine Frage der Zeit, bis der «Islamische Staat» sich mit denselben Schwierigkeiten konfrontiert sehen wird. Die Terrormiliz hat von der Situation in der irakisch-syrischen Konfliktzone profitiert und sich insbesondere die Unterstützung der politisch exkludierten Sunniten sichern können, aber sie ist blind für die gesellschaftlichen Gegebenheiten; statt sich diesen anzupassen, praktiziert der IS eine harsche, oberflächliche und buchstabentreue Lesart der Scharia, die dem kulturellen Umfeld völlig fremd ist. Die Jihadisten berufen sich auf den salafistischen Islam (wobei die Mehrzahl der Salafisten keine Jihadisten sind). Der Salafismus wird meist als Reaktion einer traditionsgebundenen Kultur und Gesellschaft auf Modernisierung und Verwestlichung wahrgenommen, aber das trifft so nicht zu: Der Salafismus ist ein Paradebeispiel für ein Religionsverständnis, das sich nicht mehr über eine Kultur, sondern über ein System von Normen definiert, auch wenn diese der im Umfeld vorherrschenden Kultur entgegenstehen. So zerstören die Wahhabiten in Saudiarabien das alte Mekka und errichten stattdessen eine westlich geprägte, kommerzielle Mall, wo die Regeln der Scharia – Ladenschliessung während der Gebetszeiten, Verschleierungszwang für Frauen – im Rahmen einer modernen Konsumkultur Anwendung finden.
Die Illusion vom «reinen» Glauben
Es sollte nicht erstaunen, dass die traditionellen islamischen Kulturen den Salafisten als Erstes zum Opfer fallen. Nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan tilgten die Taliban umgehend, was für die einheimische Kultur typisch war. Die beliebten Drachen-Wettkämpfe wurden verboten, Fussball dagegen blieb erlaubt: Wieso soll Fussball halal sein, nicht aber, Drachen steigen zu lassen? Der IS wiederum pflegt eine durchaus moderne Kultur: Seine blutrünstigen Showeffekte sind von Videospielen und Filmen inspiriert, seine Rekruten findet er unter entwurzelten und frustrierten westlichen Muslimen, er manipuliert mit Geschick die westlichen Medien und zerstört derweil das historische Erbe in seinem Machtbereich.
Es sollte nicht überraschen, dass sich in fundamentalistischen Bewegungen viele Konvertiten finden . Menschen, die öfters konvertieren, wollen das «Eigentliche» – Religion als Kulturform interessiert sie nicht. Die Europäer, die zum Islam konvertieren und in den Jihad ziehen, nehmen sich in der Regel nicht die Mühe, Arabisch oder Türkisch zu lernen; sie bleiben bei ihrer Muttersprache und garnieren diese mit ein paar arabischen Wörtern. Auch kleiden sie sich nicht wie traditionelle Saudiaraber oder Ägypter, sondern kreieren ihren eigenen Look: Weisse Gewänder und Nike-Sportschuhe scheinen zum Kennzeichen des Konvertiten geworden zu sein. Ausländische Jihadisten integrieren sich zudem nie in die Gesellschaften, für die zu kämpfen sie vorgeben. Wenn ihnen die lokale Bevölkerung ihre Töchter nicht freiwillig gibt, werden die Mädchen vergewaltigt oder entführt. Spannungen lassen nicht auf sich warten, und bald können sich die Jihadisten nur noch mit Zwangsmassnahmen durchsetzen; an die Stelle der religiösen Agenda tritt reiner Machtkampf.
Dass die Religion nicht mehr Teil des kulturellen Mainstream ist, trifft auch auf die meisten muslimischen Länder zu. Am Anfang des Arabischen Frühlings berief sich niemand auf die Religion: Die Menschen gingen für Demokratie, Freiheit und Menschenrechte auf die Strasse. Zwar gingen nach den Revolten in Tunesien und Ägypten zunächst die Islamisten als Sieger aus den Wahlen hervor, aber nach zwei Jahren wurden sie abgewählt. Sie scheiterten, weil sie geglaubt hatten, einen islamischen Staat aufbauen zu können; aber die Versuche, ein Staatswesen ausschliesslich auf Religion zu gründen, sind zum Scheitern verurteilt.
Das religiöse Terrain diversifiziert sich, Säkularismus und sogar Atheismus bieten einer jungen Generation, die sich gegen patriarchale Machtstrukturen auflehnt, neue Optionen. Diese jungen Menschen unterstellen sich nicht mehr traditionellen religiösen Hierarchien, sondern diskutieren über die Fragen, die sie beschäftigen, im Internet. In Ägypten findet so eine Öffnung und Ausweitung des religiösen Bereichs statt; allerdings bedeutet diese Demokratisierung des religiösen Denkens nicht unbedingt auch eine Liberalisierung.
Der Zerfall der Beziehung zwischen Religion und Kultur spiegelt sich indirekt in den jüngsten Debatten über Religionsfreiheit, die im Westen wie in der islamischen Welt geführt werden. In Amerika protestieren Evangelikale und Katholiken gegen «Obamacare», weil Arbeitgeber damit gezwungen sein könnten, Verhütungsmittel für ihre Angestellten mitzufinanzieren. Aus der Sicht vieler religiöser Menschen – nicht nur von Muslimen – dient Frankreichs Bekenntnis zu «laïcité» einzig der Verdrängung der Religion aus dem öffentlichen Raum. Sogar in Ländern, wo die Religionsfreiheit verfassungsmässig garantiert ist, sind Debatten über die Bedeutung dieser Freiheit entbrannt. Wo das Moralverständnis des gesellschaftlichen Mainstream zunehmend von dem religiöser Gemeinschaften divergiert, tun sich in Bereichen wie Familie, Geschlechter- und Rollenverständnis und Fortpflanzung neue Konfliktfelder auf.
Es gibt allerdings zweierlei Möglichkeiten, den Begriff Religionsfreiheit zu verstehen. Man kann sie zum einen als kollektives und spezifischer noch als Minderheitenrecht wahrnehmen; so haben etwa die Muslimbrüder kein Problem damit, die Christen als Religionsgemeinschaft zu akzeptieren. Religionsfreiheit kann aber auch im Blick aufs Individuum definiert werden, und das erweist sich in Ländern und Regionen mit einer klar dominierenden Religion gelegentlich als problematisch. Bayern verbietet Lehrerinnen das Tragen des muslimischen Kopftuchs, während Nonnen im Habit unterrichten dürfen. Italien anerkennt zwar die Glaubensfreiheit, nicht aber die Gleichberechtigung der Religionen. In islamischen Ländern wiederum sehen konservative Religionsgelehrte in der Konversion vom Islam zum Christentum eine Verletzung des göttlichen Gebots, die vom Staat untersagt werden muss. Es gibt übrigens einen direkten Zusammenhang zwischen der Demokratisierung und dem Recht, sich vom Islam abzuwenden; denn wer den Gedanken akzeptieren kann, dass das Glaubensbekenntnis ein Akt des freien Willens ist, der kann auch die Demokratie akzeptieren, und umgekehrt. Meines Erachtens findet diese Debatte nun in muslimischen Ländern statt: Die neue tunesische Verfassung ist die erste in der arabischen Welt, die Gewissens- und Glaubensfreiheit garantiert.
Pluralistisches Religionsverständnis
Ich gehe davon aus, dass im Nahen und Mittleren Osten die Akzeptanz dieser Freiheit zunehmen wird. Erstmals in der Geschichte können sich Menschen in Tunesien und Ägypten offen zum Säkularismus oder Atheismus bekennen; in Marokko und Algerien verzeichnet die Bewegung derjenigen, die das Fastengebot des Ramadan nicht einhalten, wachsenden Zulauf. Der sich abzeichnende Pluralismus im Religionsverständnis deutet klar auf eine neue Toleranz und Offenheit hin; er ist ein Zeichen der Säkularisierung. Das Fasten wird nicht mehr als Pflicht, sondern als individuelle Praxis, die Religion nicht mehr als Teil der dominanten Kultur, sondern als persönliches Bekenntnis angesehen. Diese «Dekulturierung» der Religion ermöglicht die Demokratisierung der Gesellschaft. So kann man auch nicht mehr ohne weiteres den «säkularen» Westen gegen den «religiösen» Osten halten: Säkularisierung und die Entflechtung zwischen Religion und Kultur finden im Osten wie im Westen statt.
Der Philosoph und Politologe Olivier Roy hat sich insbesondere als Experte für islamische Themen einen Namen gemacht; er lehrt am European University Institute in Florenz. Der obige Essay erschien erstmals in der «IWMpost», dem Magazin des Wiener Instituts für die Wissenschaften vom Menschen. – Aus dem Englischen von as.
Nota. - Der Islam ist doch gar nicht das Problem,* das war er höchstens für die konkurrierenden Bekenntnisse, aber nicht für uns säkulare Westler. Ein Problem ist dagegen der terroristische Islamismus, dessen Gewalt- tätigkeit sich gerade mit der fortschreitenden Säkularisierung der islamischen Kulturen steigert. Er wird zwar nie die Volksmehrheit für sic gewinnen, aber darauf legt er gar keinen Weg. Er will nicht die Herzen bekehren, sondern die Leiber zwingen.
JE
*) Das sehe ich inzwischen anders. Jan. 2017
Wie ursprünglich ist der Koran?
aus derStandard.at,13. Dezember 2014, 17:00 Eine Seite der Koran-Handschrift Ma VI 165. Sie wurde mit der C14-Methode auf die Zeit zwischen 649 und 675 datiert
Was die Muslime schon immer sagten
Dass
der Koran in seiner heutigen Form aus der frühislamischen Zeit stammt,
wurde oft angezweifelt. Heute ist die Quellenlage überzeugendvon GUDRUN HARRER
Die Weltreligion Islam hatte es - schon vor der schweren Beschädigung durch Al-Kaida und Islamischen Staat - im Westen nie leicht: Als Epileptiker wurde etwa sein Prophet von frühen Autoren beschrieben, dessen krause Fantastereien irgendwann viel später zu einem Buch zusammengestoppelt wurden. Manche sogenannte Islamkritiker gingen später bis zur Behauptung, es handle sich quasi um eine "erfundene" Religion, auch das Personal - wie Muhammad selbst - habe gar nie existiert.
Ohne deshalb an die göttliche Offenbarung glauben zu müssen, lässt sich nüchtern konstatieren, dass im Gegensatz zu all diesen Behauptungen die Quellenlage aus der frühislamischen Zeit ganz hervorragend ist. Und sie wird immer besser: Im November informierte die Universität Tübingen in einer Presseaussendung über die naturwissenschaftliche Datierung eines aus ihrem Bestand stammenden Koranfragments auf die Jahre 649 bis 675 unserer Zeitrechnung, statistische Wahrscheinlichkeit 95,4 Prozent.
Muhammad starb 632, demnach geht es um eine Textprobe aus der Zeit zwanzig bis vierzig Jahre nach dessen Tod. Nach islamischer Überlieferung versuchte gerade in jener Zeit der dritte Kalif, Uthman Ibn Affan (644-656), einen einheitlichen Kodex der zuvor gesammelten Koranverse durchzusetzen, und schickte dazu Standardexemplare in die islamischen Provinzen. Wissenschaftlich belegt ist das nicht.
Siebenundsiebzig Blätter
Die Tübinger Handschrift mit der Signatur Ma VI 165 ist ein substanzielles Stück, mit 77 Blättern macht sie gut zwanzig Prozent des Korans aus (von Sure 17,37 bis 36,57). Allerdings ist die Abmessung der Blätter klein - das Buch entsprach demnach nicht dem, was man sich unter einem Referenzkodex vorstellt. Gerade deshalb wäre er nicht erstaunt gewesen, wenn eine etwas spätere Datierung, um 700, herausgekommen wäre, sagt Michael Marx am Telefon zum Standard.
Er ist Leiter der Arbeitsstelle "Corpus Coranicum" an der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften. Zusammen mit französischen Wissenschaftern arbeiten die Deutschen an einem Projekt, das erstmals auch auf materielle Erzeugnisse zur Erforschung der koranischen Textgeschichte setzt. Dabei kommt zur paläografischen und zur orthografischen Analyse die Datierung mithilfe der an der ETH Zürich durchgeführten Radiocarbonmethode (sie misst den Zerfall radioaktiver C14-Isotope).
Archaischer Schreibstil
Bei der Handschrift Ma VI 165 ergab die Untersuchung von drei an unterschiedlichen Stellen entnommenen Proben eine frühere Datierung, als Paläografie - der Schriftstil - und Orthografie erwarten ließen. Der ursprüngliche Text ist im archaischen und nichtkalligrafischen Hijazi-Stil geschrieben, früher wurden diese frühen Schriftarten meist generell als "kufisch" zusammengefasst.
Untersucht wird allerdings nur der Beschreibstoff, in diesem Fall das Pergament, eine Tintenuntersuchung ist noch nicht möglich. Auf Ma VI 165 wurden im ursprünglichen Text, der nicht alle Buchstaben eindeutig notiert, später in roter Tinte Vokalzeichen eingesetzt und noch einmal später mit schwarzer Tinte die frühere Version eindeutig geschrieben.
Wenn nur annähernd Sicherheit über das Pergament besteht, könnten demnach nicht doch jene recht haben, die meinen, der Koran wurde erst viel später aufgeschrieben und in einem Buch gesammelt? Theoretisch möglich, aber sehr unwahrscheinlich, sagt Marx: Pergament sei ein teurer Beschreibstoff gewesen, und dass dieser womöglich jahrzehntelang gehortet worden wäre, wäre sehr unökonomisch gewesen.
Dreißig größere Fragmente
Dagegen spricht wohl auch die große Anzahl von physischer Evidenz aus dieser frühen Zeit. Marx nennt dreißig größere Fragmente (insgesamt bis zu 2000 Blättern), die im ersten islamischen Jahrhundert anzusiedeln seien - eine ganz erstaunliche Anzahl, verglichen mit der Textüberlieferung anderer antiker und spätantiker Texte. Weitere Forschungsergebnisse sind für Jänner und Februar zu erwarten, dabei handelt es sich gleich um ein Koranfragment von 210 Blättern sowie sieben aus einem Kodex, von dem weitere 31 Blätter unzugänglich in einem Archiv in Kairo schlummern.
Der große Berliner Kodex von 210 Seiten hat die gleiche Herkunft wie Ma VI 165: Sie stammen aus der Sammlung des preußischen Konsuls Johann Gottfried Wetzstein, der in den 1850ern in Syrien seiner Leidenschaft für alte Handschriften frönte. Ob seine Erwerbungen auch in diesem Raum entstanden sind, ist ungewiss - hier hofft man auf zukünftige genetische Forschungen an Pergamenten, die ja von Schafen stammen. Heute sind die Handschriften des Konsuls in Tübingen, Leipzig und Berlin, wo Wetzstein im Februar mit einer Konferenz geehrt wird.
Erste naturwissenschaftliche Datierungen in unterschiedlichen Laboren gab es bereits in den vergangenen fünfzehn Jahren, aber "Coranica" ist mit bisher etwa vierzig Proben die erste größere systematische Messkampagne: Die physischen Zeugnisse des Koran standen noch nie im Mittelpunkt der Forschung, obwohl doch die Datierung eine sehr emotionelle Komponente zu enthalten scheint - denn wenn etliche Koranwissenschafter dem muslimischen Narrativ von früher Niederschrift und Sammlung der koranischen Offenbarungen widersprachen, lief das doch irgendwie auf eine Delegitimierung hinaus.
Verschiedene Theorien
Die 1970er-Jahre waren in dieser Beziehung eine extrem kontroverse Zeit, da wurden innerhalb weniger Jahre sehr unterschiedliche Standpunkte publiziert: von John Burton, der fast allein mit der Ansicht dastand, dass der heutige Koran die vom Propheten Muhammad stammende Fassung sei (The Collection of the Qur'an, 1979), bis zu John Wansbrough, der sagte, der Koran sei erst im 9. Jahrhundert erstellt worden (Quranic Studies, 1977).
Dazu gab es etliche andere Theorien, keine folgte dem, was die Muslime glaubten. Und keiner dieser Forscher, so Marx, habe sich die Handschriften angesehen: unvorstellbar in einer Zeit wie heute, wo wiederum gerade die materielle Evidenz eine besondere Faszination auszuüben scheint - und vielleicht Erwartungen weckt, die auch nicht zu erfüllen sind.
Eigentlich, so Marx, komme der jetzige Medienrummel zu früh, erst nächstes Jahr werde es einen Gesamtüberblick über die Untersuchungsreihe geben, inklusive der Unschärfen der Datierungen. Die "Coranica"-Forscher sind sehr vorsichtig - und das Bemühen um eine Absicherung der Ergebnisse lässt sie etwa auch sehnsüchtig nach Wien, zur Wiener Papyrussammlung, blicken. Sie hat frühe Koranfragmente, aber auch bedeutende Papyri, und zwar mit Kolophon, also einer Datierung.
Die Wiener Papyri
Die naturwissenschaftliche Untersuchung von datierten Fragmenten dient dazu, die C14-Methode zu verifizieren. Aber aus Wien hätten sie - so wie etwa auf ein Drittel ihrer zwanzig Anfragen - eine ablehnende Antwort bekommen, erzählt Marx. Immerhin muss man der Handschrift ein Quadratzentimeter großes Stück entnehmen: ein klassischer Konflikt zwischen Forschung und Erhaltung. Aber im Moment gebe es dafür die Hoffnung auf Probeentnahmen von Bibelhandschriftenaus einer vergleichbaren Zeit.
"Beweise" könne das nicht liefern, meint Marx, aber wichtige Indizien dafür, dass der Koran tatsächlich aus der frühislamischen Zeit stammt. Dass es so viele Belege gibt, hängt gewiss auch damit zusammen, dass der Islam schon früh eine politisch erfolgreiche Religion war - ganz im Gegensatz zum Christentum, das erst einmal im Verborgenen existierte. Die Buchform des Neuen Testaments als Kodex kam erst auf, als es Staatsreligion wurde. Und die Muslime, die sind von der Fülle des Koranmaterials aus dem ersten islamischen Jahrhundert eher unbeeindruckt: Sie haben es ja schon immer gewusst.
Nota. - Der Koran ist nach muslimischer Auffassung - anders als Altes und Neues Testament - GOttes eigenes Wort, nämlich so, wie es von Gabriel dem Propheten auf die Zunge gelegt wurde. Daher kann er, anders als jene, nicht durch menschliche Vernunft ausgelegt werden. - Offenkundig steht dieser Glaubenssatz der historischen Anpassungsfähigkeit dieses Dogmenpakets energischer entgegen als das Eingeständnis menschlicher Überlieferung bei Juden und Christen.
Bleibt nur die Frage: Wie ursprünglich ist dieses Dogma in der koranischen Überlieferung? Die Mitteilung der koranischen Texte durch Gabriel wird in einer Reihe von Suren selbst bekundet. Von wann aber stammt der Wortlaut dieser Suren? Und wie wörtlich wurden sie ursprünglich verstanden? Gibt es in der Überlieferung der koranischen Texte einen Moment nachträglicher Dogmatisierung (mit der die geistige Stagnation des Islam seit etwa dem 11. Jahrhundert zu korrelieren wäre), oder war der Text exklusiv von Anbeginn? Realhistorisch wenig interessant, aber geistesgeschichtlich schon...
JE
Das Kalifat.
.jpg)
aus nzz.ch, 10. 7. 2014 Abu Bakr, Gefährte und Nachfolger Mohammeds, schützt diesen gegen die Steinwürfe der Ungläubigen
Das Kalifat im Wandel der Zeit
Statthalter Gottes – Strohmann der Mächtigen
Wie ein Echo aus längst vergangener Zeit mutet die Ausrufung eines Kalifats im Machtbereich der extremistischen Gruppierung Isis an. Wie definierte sich die Macht des Kalifen im Lauf der islamischen Geschichte, und in welchem Verhältnis zur Vergangenheit steht das Selbstverständnis der Extremisten?
Pathetisch verkündete der Sprecher der islamistischen Extremistengruppe Isis, Abu Muhammad al-Adnani, am 29. Juni die Ausrufung des Kalifats und die Einsetzung von Ibrahim Awwad Ibrahim, alias Abu Bakr al-Baghdadi, als Kalifen. Schon die Wahl des Nom de guerre Abu Bakr liess vermuten, dass Ibrahim Grosses im Sinn hatte, war doch Abu Bakr der erste Nachfolger, das heisst der erste Kalif, des Propheten Mohammed gewesen. Al-Baghdadis Vorstellung vom Kalifat kann als eine Neuerfindung gelten; sie deutet eine ultrareligiöse Heilsherrschaft mit mittelalterlichen Ordnungsmustern, die auf die islamische Frühzeit projiziert werden.
Zwischen Moschee und Palast
Als herrschaftliche Ordnung wurde das Kalifat erstmals von mittelalterlichen Gelehrten wie al-Mawardi (972–1058), al-Djuwayni (1028–1085) und al-Ghazzali (1058–1111) systematisch beschrieben. Dabei war man sich schon damals keineswegs einig, ob es überhaupt ein Kalifat geben müsse. Die einen meinten, das Kalifat habe den Zweck, Herrschaft an den Islam anzubinden und die Herrschaftsordnung dem islamischen Recht zu unterstellen; ohne Kalifat würde unter Muslimen nur Zwietracht herrschen. Die anderen erachteten das Kalifat als eine Form von religiöser Vertretung der islamischen Ökumene, die zwar empfehlenswert, aber nicht unabdingbar sei. Theoretisch sollte der Kalif, so al-Ghazzali, zwei Aufgaben erfüllen: die des Imams, das heisst bei ihm die Führung der Muslime in den Angelegenheiten der Religion, und die des Sultans, das heisst die Exekutive einer Herrschaftsordnung. Letztere Funktion aber habe er nicht persönlich auszuüben, sondern an König, Sultane und Fürsten zu delegieren, die sich wiederum vertraglich zur Anerkennung des Kalifen verpflichten müssten.
Das damalige Gerangel um die Legitimität des Kalifats hatte durchaus historische Gründe. Um das Jahr 1000 existierten in der damaligen islamischen Welt gleich drei Kalifate: das abbasidische Kalifat von Bagdad, das ismailitisch-schiitische von Kairo und das umayyadische von Cordoba in Spanien. Nach dem Sturz der Umayyaden in Spanien 1031 und dem der Fatimiden in Ägypten 1171 blieb abgesehen vom allein in Nordafrika anerkannten Kalifat der Almohaden (1130–1269) nur noch das auf einen sehr kleinen Machtbereich geschrumpfte Kalifat von Bagdad übrig, ehe auch dieses 1258 nach der Eroberung durch die Truppen des Mongolen Hülegü unterging. Die symbolische Bedeutung des Kalifats blieb allerdings bestehen: Al-Hakim, ein abbasidischer Flüchtling aus Bagdad, wurde von mamlukischen Fürsten in Aleppo und Kairo 1261 als Kalif eingesetzt, einzig mit dem Ziel, grössere Allianzen bilden zu können.
Denn schon damals war das Kalifat nur noch ein Instrument, Allianzen zwischen Fürsten durch die symbolische Bindung an einen Kalifen zu bilden. Herrschaftliche Macht hatten dieser Kalif und seine Nachfahren nicht. Der letzte dieser sogenannten Schattenkalifen war al-Mutawakkil III., der 1517 vom osmanischen Sultan Selim I. abgesetzt wurde. Im späten 18. Jahrhundert entdeckten die osmanischen Sultane das Kalifat neu und nutzten es, um ihren Geltungsanspruch gegenüber muslimischen Gemeinschaften, die nach den Gebietsverlusten nicht mehr ihrer Herrschaft unterstanden, zum Ausdruck zu bringen. Eine herrschaftliche Funktion hatte das Kalifat auch dann bis zu seiner offiziellen Abschaffung im Jahre 1924 nicht.
Nachfolge des Propheten
Die seit al-Mawardi tradierte scholastische Normenordnung hatte praktisch nichts mit dem damaligen realen Kalifat zu tun. Doch ohne eine historische Imagination kommt heute ein Kalifat nicht aus. Diese bildet einen zweiten Pfeiler, auf den sich der von al-Baghdadi verkündete «Islamische Kalifatsstaat» stützt. Sie bezieht ihre Bilder aus der Zeit der ersten Nachfolger des Propheten Mohammed, der Kalifen Abu Bakr (Kalif von 632 bis 634), Umar (634–644) und Uthman (644–656). Diese drei Personen werden nun als Figuration der spätmittelalterlichen Normenordnung gedeutet und so beschrieben, als wären sie reale Herrscher im Sinne dieser Normen gewesen. Doch die Herrschaftsgewalt der ersten Kalifen lässt sich kaum mit diesen Normen in Beziehung bringen. Dies liegt vor allem daran, dass sie eben als Nachfolger des Propheten Mohammed galten; eine Nachfolgeschaft dieser Art liess sich nur auf jene beziehen, die tatsächlich aus dem direkten Umfeld des Propheten kamen. Die Partei des vierten Kalifen Ali (656–661), des Cousins und Schwiegersohns Mohammeds, hatte von Anfang an darauf gepocht, dass allein die Familie Alis legitimiert sei, die Führung der Kultgemeinschaft auszuüben.
Diese vier ersten, die sogenannten «rechtgeleiteten Kalifen» aber waren keine Cäsaren. Ihre Befehlsgewalt beschränkte sich auf das, was die islamische Kultgemeinschaft kennzeichnete; so waren sie zunächst Vorsteher im Kult. Daneben wirkten sie als Hüter des «Schatzhauses» und damit als diejenigen, denen die Befehlsgewalt über die Gemeinde der Gottestreuen anvertraut wurde, sowie als Schiedsrichter in den Angelegenheiten, die als Verletzung der Grenze zwischen dem Kult und der Sozialwelt galten. Diese Bevollmächtigung war aber verschieden von der Herrschaft, welche die sozialen Verbände, mithin die Stämme, ausübten und die sich zum Beispiel in der Privilegierung bei der Beuteverteilung oder in den Eroberungszügen zeigte. Die Befehlsgewalt der ersten vier Kalifen bezog sich auf Anliegen der Kultgemeinde. Alles Leben jenseits dessen, was sich auf den Kult beziehen liess, unterstand nicht ihrer Autorität.
Dieses frühislamische Kalifat verlor aber nach 660/680 zunächst unter den Umayyaden, dann unter den Abbasiden an Bedeutung, da sich die Kalifen nun nicht mehr als Nachfolger des Propheten sehen konnten, sondern sich stattdessen als «Stellvertreter» oder «Sachwalter» Gottes auf Erden verstanden. Hierzu wurde gerne von den beiden einzigen Stellen im Koran Gebrauch gemacht, in denen der Begriff Kalif auftaucht: In 2:30 wird davon gesprochen, dass Gott Adam als «einen Nachfolger» einsetzen wird, und in 38:26 wird David als jemand bezeichnet, den Gott als Nachfolger (zu ergänzen wäre wohl: früherer Herrscher) eingesetzt habe. Gelesen wurden beide Verse als Hinweis darauf, dass Gott einen Menschen als Herrscher einsetzen könne und dass ein so von Gott privilegierter Herrscher Kalif sei.
Dies erinnert natürlich an die mittelalterliche Diskussion um das Gottesgnadentum und an die berühmte Stelle im Römerbrief 13:1: «Jedermann sei untertan der Obrigkeit, die Gewalt über ihn hat. Denn es ist keine Obrigkeit ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott verordnet.»
Streng genommen gab es also zwei Formen des Kalifats: die frühe Nachfolgeschaft des Propheten Mohammed und die von Gott verordnete Herrschaft. Natürlich stellte sich für islamische Juristen die Frage, wie der Akt der Einsetzung des Herrschers durch Gott gedacht werden könne. Für die meisten ergab sich die Notwendigkeit der Zustimmung. Nur dann könne eine Herrschaft als Kalifat, also als von Gott eingesetzt, gedacht werden, wenn es eine hinreichende Zustimmung der Gemeinde gebe, wenn die Einsetzung durch ein Beratungsgremium erfolge und wenn der potenzielle Kalif über einen Fähigkeitsnachweis verfüge.
Eine Minderheit nutzte diese allgemeine Rahmenordnung, um das Amt des Kalifen theoretisch jedermann zugänglich zu machen, denn allein in der Zustimmung äussere sich der Wille Gottes. Die Mehrheit allerdings beharrte darauf, dass die Nachfolge immer genealogisch zu verstehen sei: Zwar könne ein Herrscher von Gott eingesetzt und damit Kalif sein, aber nur in der genealogischen Nachfolge bilde sich der ursprüngliche Wille Gottes weiterhin ab. Daher war das Kalifat bis 1924 stets eine dynastische Ordnung. Versuche, unabhängig von einer solchen Ordnung einen Kalifen einzusetzen, sind in der islamischen Geschichte stets gescheitert. Das Kalifat wurde so zu einem Qualifikationsmerkmal königlicher Herrschaft und damit zum Bestandteil königlicher Titulatur; der Titel definierte nur noch den nie eingelösten Anspruch, eine Allianz der gesamten islamischen Ökumene zu bilden. Ein Primat der religiösen Auslegung oder gar die Normierung einer islamischen Ordnung fiel nicht in den Aufgabenbereich des dynastischen Kalifats.
Al-Baghdadi beansprucht, beide Formen des Kalifats in einer Ordnung zu vereinen. Symbolisch wurde die Prozedur wiederholt, die der Überlieferung nach 632 zur Bestimmung von Abu Bakr als erstem Kalifen geführt hatte: Die Männer, welche «die Löse- und Bindegewalt innehätten», hätten die Etablierung des islamischen Kalifats verkündet und Abu Bakr al-Baghdadi eingesetzt. Diese frühislamisch inspirierte Szene wird dann kombiniert mit dem normativen Geltungsanspruch eines von Gott eingesetzten Kalifats. Schliesslich wird noch eine genealogische Bestimmung erfüllt, indem al-Baghdadi als Haschemit identifiziert wird, der in direkter Linie vom Propheten Mohammed abstamme.
Renaissance der Kalifatsidee
Nach der Absetzung des letzten osmanischen Kalifen 1924 war der Begriff «Kalif» nur noch Topos einer innerislamischen Selbstauslegung. Alle Versuche, damals bestehende arabische Monarchien mit dem Begriff «Kalifat» aufzuwerten, scheiterten schon im Ansatz. In der politischen Fiktion hingegen zeichnete sich schon 1950 eine Neuerfindung eines republikanisch erscheinenden islamischen Kalifats ab. Es wurde nun für eine Minderheit zur Zentralfigur einer islamischen Utopie, für die der palästinensische Richter Taqi ad-Din an-Nabhani (1909–1977), Gründer der islamischen Befreiungspartei, 1953 sogar eine Verfassung schrieb. Dort heisst es: «Der Kalif ist derjenige, der die Umma in der Ausübung der Herrschaftsmacht und der Durchführung des islamischen Rechts vertritt.»
Das Kalifat selbst wurde definiert als «ein auf Zustimmung und freier Wahl beruhender Vertrag». Der Begriff Kalif hat also nicht mehr den Sinn einer Nachfolgeschaft, sondern den einer transnationalen staatlichen Herrschaft. Doch in al-Baghdadis ultrareligiöser Vision spielt dieser Gedanke keine Rolle mehr. Stattdessen verknüpft er das Kalifat mit einem Heilsversprechen. Al-Baghdadi, der sich nun als «Kalif aller Muslime» und das Kalifat selbst als «Versprechen Gottes» bezeichnet, verkündet, dass die Zustimmung zu seinem Kalifat das Seelenheil garantiere. Entsprechend wird nun der Treueschwur auf den Kalifen zu Pflicht erklärt; wer diesen nicht leiste, sei ein Abtrünniger. Die neue Ordnung heisst nun «islamischer Kalifatsstaat»; al-Baghdadi war sich wohl nicht bewusst, dass die arabische Formulierung «Kalifatsstaat» von vorneuzeitlichen arabischen Autoren fast ausschliesslich benutzt wurde, wenn es um den Untergang des abbasidischen Kalifats im Jahr 1258 ging.
Erdogan sei Dank, oder: Es hat alles zwei Seiten.
Falls Sie ihn übersehen haben: hier nochmal mein Kommentar zu Erdogans schleichendem Putsch - und zu den Türken in Deutschland.
...Die europäische Aufklärung, die die Voraussetzung moderner rechtlicher Staatlichkeit ist, bezog ihre Kraft daraus, dass hier nicht nur die Religion ihren Zugriff auf den Staat verlor, sondern auch der Staat nie wirkliche Macht über die Religion hatte. Das war nur möglich, weil weltliche und geistliche Autorität in zwei rivalisie-renden Institutionen organisiert und gebunden war, die römisch Kirche und den deutschen Kaiser.
In keinem islamischen Land ist bis heute die Religion Privatsache geworden, weil sie sich dort nie gegen das Politische verselbständigen konnte. Der Islam ist im wesentlichen eine Gesetzesreligion und kann sich nur schwer aus dem öffentlichen Leben heraushalten; doch noch weniger kann einem Machthaber kann daran gelegen sein, sie zu seinem Rivalen aufzubauen. Und so hat Kemal Atatürk wohl das Kalifat abgeschafft, aber auch das Religions-ministerium gegründet. Auch Zafer Şenocak politisiert ja in Glaubensdingen, wenn auch in anderer Richtung als Erdogan.
Eine Geschichte von vierzehn Jahrhunderten lässt sich nicht rückwirkend umschreiben. Auch nicht dies, dass in keinem muslimisch besiedelten Gebiet sich bis heute eine wirkliche Nation* hat ausbilden können, so dass der Islam von jedem Demagogen als Identitätsstifter in Anspruch genommen werden kann.
In dem Punkt hat die Türkei einen Vorzug gegenüber den anderen muslimischen Völkern, und der liegt ausge-rechnet in einem ihrer wundesten Punkte: der Massenauswanderung nach Deutschland.
Dieser Tage hören wir, es müsse verhindert werden, dass die inneren Konflikte der Türkei auf deutschem Boden ausgetragen werden. Sie sollte sich das vermeiden lassen? Unter den in Deutschland lebenden Türken sind rund ein Drittel Kurden. Das hat sich auch nicht unterm Deckel halten lassen. Das nachhaltige kurdische Nationalproblem war der Hauptgrund für das Aufkommen eines politischen Islamismus in der kemalistischen Republik. ...
Das ist ein wunder Punkt, aber noch nicht der wundeste. Die große Masse der Türken in Deutschland bildet hier eine nationale Minderheit, aber keine autochthone, sondern als Außenposten eines fremden Staates, in dem sie sich ebenso oder mehr zu Hause fühlen als hier. Hier in einem Gastland, zu dem weder sie alle noch auch nur ihre Elite eine historische und kulturelle Verbindung haben! Inder, Pakistaner und Westindier in Großbritannien, Nord- und Schwarzafrikaner in Frankreich verbindet mit dem Land, in dem sie leben, eine lange Kolonialgeschichte, die noch immer für böses Blut sorgen mag, aber auf beiden Seiten ein Teil der jeweiligen Identität bildet; einen gemeinsamen Teil. Das Zusammenleben der Ethnien ist schon in diesen Ländern, wo die Minderheiten eine Brücke bilden könnten und in den Bildungseliten tatsächlich bilden, prekär genug. Doch ein Großteil der Türken in Deutschland spricht nicht einmal die Sprache der Deutschen, und man hat den Eindruck, als habe die Fremdheit in vergangenen Jahrzehnt eher zu- als abgenommen.
Und da ist Erdogans coup d'état permanent - so nannte Fr. Mitterand den Regierungsstil des General de Gaulle - womöglich ein Geschenk der Geschichte. Deutschland mit seiner millionenfachen türkischsprachigen Leser-schaft wird ganz selbstverständlich zur Rückzugsbasis der türkischen Presse- und Gedankenfreiheit werden, hier herrscht Vereinsfreiheit und ist die türkische Population groß genug, ein diversifiziertes politisches Leben zu nähren und zu unterhalten. Mit andern Worten, wenn Erdogan so weitermacht, dann wird es eine historisch-kulturelle Verbindung zwischen der Türkei und Deutschland geben, und Erdogan wird es noch bedauern.
Während bislang die türkische Minderheit in Deutschland ein weltweites Unikum darstellte, wird sie dann - erst recht ein weltweites Unikum sein.
*) In ganz Nordafrika sind ein Großteil der Bewohner Berber und sprechen - und schreiben sogar - eine hamitische Sprache. Nicht nur in der Türkei, auch im Irak sind die Kurden eine bedeutende Minderheit. Allenfalls die Jemeni-ten können auf ein lange staatliche Geschichte zurückblicken - von der aber heute nichts übriggeblieben ist.
Ob ein Volk sich zur Nation bildet, hängt von anderen Faktoren ab als der Religion. Aber der Islam ist ein zusätz-liches Hemmnis. Zumal, seit er zum Ersatz des verlogenen "panarabischen Nationalismus" geworden ist, der im 20. Jahrhundert das stärkste Bollwerk gegen die Volkssouveränität war.
Donnerstag, 11. August 2016
Die Islamisierung der säkularen Republik
Religiöser Kulturkampf in der Türkei
Laizismus war in der Türkei stets ein Projekt der Eliten. Die Doktrin kam bei der Mehrheit der Menschen nicht an. Nun kehrt der Islam als politische Ideologie zurück.
von Zafer Şenocak
«Allahu akbar», Gott ist gross, skandierte die Menge, die sich, von den Moscheen aus mobilisiert, auf den Strassen Ankaras und Istanbuls dem putschenden Militär entgegenstellte. Es ging ihr dabei nicht um die Verteidigung demokratischer Werte. Diese waren von der Herrschaft unter Recep Tayyip Erdoğan längst ausgehöhlt, sinnentleert. Stattdessen wurden Teile der sunnitischen Bevölkerung in einen politisierten Islam hineingezogen, der für die Menschen an den Rändern der Gesellschaft attraktiver zu sein scheint als die aufklärerischen Ideale der säkularen türkischen Republik.
Einst war die Türkei das Vorzeigeprojekt des Westens in der islamischen Welt gewesen. Staat und Religion waren getrennt. Die Bildungsinstitutionen des Landes orientierten sich an westlichen Hochschulen. Auch der wirtschaftliche Aufstieg der Türkei beruhte auf dieser Grundlage. Ein an Rohstoffen armes Land arbeitete sich durch Bildung und Forschung empor.
Die türkische Kulturrevolution
Doch der Laizismus war ein Projekt der Elite. Er ging im Herzen vieler vor allem einfacher Menschen in der Türkei niemals auf. Er blieb ein unauflösbarer Knoten in der muslimischen Seele des Landes. Der Islam kannte keine Kirche, war aber wohl ein ordnendes System, das bis in den Alltag vorzudringen vermochte. Auch die Politik war durchsetzt von religiösen Begriffen, selbst wenn sie ganz eigene Wege ging.
Die türkische Republik hatte sich unter Kemal Atatürk vom islamischen Jihad verabschiedet. Die Türkei sollte ein angesehenes Mitglied der abendländisch geprägten europäischen Familie werden. Der Lehrer und der Offizier repräsentierten fortan die moderne Türkei. Der Imam dagegen die Rückständigkeit. Alle modernistischen Reformen in der Türkei hatten einen kulturalistischen Kern. Sie implizierten, dass die westlichen aufklärerischen Werte im Vergleich mit den orientalischen, muslimischen Werten überlegen waren. Gipfelpunkt der türkischen Kulturrevolution war die Übernahme der lateinischen Schrift. Die arabischen Lettern gehörten der Vergangenheit an.
Die Türken schrieben nun lateinisch, aber dachten sie mehrheitlich auch westlich? Hatten die Werte der Aufklärung auch eine philosophische Entsprechung in der Türkei? Ohne Zweifel erreichten diese Werte die gebildeten Schichten. Doch für lange Zeit bildeten diese Schichten nur eine Minderheit in der Gesellschaft. Freilich eine elitäre Minderheit, die auf die Mehrheit herabschaute.
Während der Einparteienherrschaft von 1923 bis 1946 wurde in der Türkei eine ambitionierte Kulturrevolution eingeleitet. Per Dekret wurde die Modernisierung verordnet. Doch wie zivilisiert man die Massen, wenn keine Erziehungsdiktatur mehr herrscht, sondern das Volk in freien Wahlen seine Regierung bestimmen kann? Im Grunde genommen laboriert die Türkei immer noch an dieser Frage.
Nicht zufällig haben alle konservativen Regierungen der Türkei versucht, die Re-Islamisierung des Landes über Korrekturen im Bildungswesen voranzutreiben. Schule gleich Aufklärung war die Devise der türkischen Republik. Die religiös motivierten Gegenkräfte versuchten die Bildungshoheit der Aufklärung zu brechen. So wurde aber zugleich auch die Reform des islamischen Glaubens blockiert. Eine solche Reform wäre indes nur durch eine philosophische und textkritische, sprich: aufgeklärte Auseinandersetzung mit den Quellen der Religion möglich gewesen.
Ansätze hierfür waren und sind immer noch da. Vor allem die Universität Ankara, an der einst auch Annemarie Schimmel lehrte, gilt als eine Hochburg der zeitgemässen muslimischen Theologie. Es ist kein Zufall, dass Bedeutung und Einfluss dieser renommierten Hochschule in der Regierungszeit der islamisch konservativen Partei AKP deutlich in den Hintergrund gedrängt worden sind.
Stattdessen wurden die Imamschulen favorisiert. Sie spielen eine zentrale Rolle in der Etablierung eines konservativen sunnitischen Islams. Inzwischen haben diese Schulen fast eine Million Schüler. Hier sollen nicht nur Prediger für die Moscheen des Landes ausgebildet werden. Eine Generation frommer Jugendlicher wird hier doktrinär ausgebildet, die in Zukunft ganz selbstverständlich eine Islamisierung des türkischen Alltags verwirklichen wird. Die Imamschulen sorgen für die Pflege und Weitergabe eines traditionellen sunnitischen Islams, der mit einer heterogenen Moderne nur schlecht kommuniziert und auch wenig dialogfähig ist, wenn es um Andersgläubige geht.
Darum lautet die Kernfrage für die Zukunft: Wie leben Muslime mit anderen Menschen zusammen? Wie leben sie im eigenen Land, in der Türkei, wo es auch Millionen aufgeklärter junger Menschen gibt, die mit der ganzen Welt kommunizieren? Und wie sollen sie in der Diaspora leben, beispielsweise in Deutschland, wo die Muslime eine Minderheit in demokratischen offenen Gesellschaften bilden?
Das Zusammenleben braucht eine überbrückende Sprache. Wer an eine solche Sprache denkt, kann gar nicht anders als melancholisch werden. Die Türkei war das Land, in dem eine solche Sprache seit gut zwei Jahrhunderten eingeübt wurde. Welche Zukunftschancen werden hier jetzt verspielt? Erfahrungsschätze von Generationen, die sich zwischen Tradition und Moderne virtuos und kreativ bewegten, werden einfach verschleudert. Die Dimension dieses Verlusts hat durchaus globale Auswirkungen. Er wird auch Europa tangieren.
Viel Hass und Misstrauen hat sich zwischen den Kulturen angesammelt. Es ist der Unrat jahrhundertealter Konflikte, die bestenfalls nur notdürftig verdrängt worden sind. In Europa wurden die Glaubenskriege mühsam im Prozess der Aufklärung überwunden. Auf dem Balkan, im Osten Europas, im Nahen Osten und in Afrika aber sind Glaubenskriege nicht eine Angelegenheit von gestern. Überall dort hat Erdoğan seine Anhänger und Bewunderer. Wo die verletzte Psyche enttäuschter Massen auf den Glauben als sinnstiftenden Mythos stösst, entsteht Fanatismus.
Es ist die uralte Geschichte der Menschheit, die sich von der eigenen dunklen Seite zu befreien sucht und dabei in die Schattenwelt von Gewalt und Unfreiheit zurückfällt. Der islamischen Welt ist der Gedanke der Freiheit nicht so fremd, wie im Abendland oft angenommen wird. Es ist modisch geworden, den Mangel an Mündigkeit in der islamischen Welt allzu schnell zu akzeptieren, ja als gottgegeben anzusehen.
Dabei gibt es durchaus ein freiheitliches Narrativ in der islamischen Tradition, nämlich im Sufismus. Er ist nach wie vor eine wichtige Inspirationsquelle für die Künstler, für Dichter, Musiker und Baumeister. Man denke nur an die Romane von Orhan Pamuk.
Gewiss scheint es mehr als tollkühn, alle Hoffnung auf die Befreiung der islamischen Theologie von ihren dogmatischen Verirrungen in ketzerische Freidenker zu setzen, die vor tausend Jahren gelebt haben. Denn in mancher Hinsicht mutet die islamische Mystik heute wie harmlose Folklore an. Doch die muslimischen Wanderderwische verkündeten jahrhundertelang einen weltoffenen, menschenfreundlichen Islam. Damals blühten auch die Wissenschaften in der islamischen Welt auf.
Ein Gegengift
Aus diesen kreativen Denktraditionen könnte ein muslimischer Humanismus entstehen, der auch in der Gegenwart wieder eine erzieherische, wertorientierte Aufgabe übernehmen könnte. Dabei käme es vor allem darauf an, den Stimmen von Einzelgängern und Querdenkern wieder einen Platz einzuräumen: in den Lehrplänen der Schulen wie in der Gesellschaft.
Vor allem Gedichte und Denksprüche der Sufis sind auch heute noch sehr populär. Im Gegensatz zur religiösen Erbauungsliteratur werden sie in allen Schichten der Gesellschaft gehört und gelesen, sie verbinden Menschen mit unterschiedlichen Zugehörigkeiten und spalten nicht. Sie bleiben unverwechselbar, weil sie das Recht des Menschen auf eine eigenständige Stimme und Blickweise verteidigen. Sie sind Gegengift gegen die Sprache von Politikern, die Hass säen und die Gemeinschaft für ihre Zwecke vereinnahmen wollen.
Doch was vermögen Gedichte und Denksprüche gegen die Despotie religiöser Fanatiker? Vielleicht nichts, aber es wäre den Versuch wert.
Brief an den Vater
rbl. ⋅ Der Schriftsteller Zafer Şenocak wurde 1961 in Ankara geboren, verbrachte dort und in Istanbul die Kindheit, ehe seine Familie Ende der 1960er Jahre in die Bundesrepublik emigrierte. Zafer Şenocak debütierte 1983 mit Gedichten, denen weitere Lyrikbände, Prosa und Essays folgten. Im Münchner Babel-Verlag ist soeben unter dem Titel «In deinen Worten» eine Hommage an seinen Vater erschienen. In der Form eines langen Briefes setzt er sich mit der Gedankenwelt und Frömmigkeit seines Vaters, eines Publizisten und Verlegers, auseinander. Er sucht die Orte seiner Kindheit auf, um neue Wege zu entdecken. Schliesslich regt Şenocak die Gründung eines islamischen Kollegs an, das eine «muslimische Charta für moderne Zeiten» gegen die Despoten des Fundamentalismus zu erarbeiten hätte.
Nota. - Das Kernproblem hat er wohl doch nicht recht erfasst. Er redet von einer "Trennung von Staat und Religion" in der kemalistischen Republik. Sind Staat und Religion in einem Land, wo es ein Religions-ministerium gibt, das die Ausbildung der Prediger finanziert und kontrolliert, getrennt?
In keinem islamischen Land ist bis heute die Religion Privatsache geworden, weil sie sich dort nie gegen das Politische verselbständigen konnte. Der Islam ist im wesentlichen eine Gesetzesreligion und kann sich nur schwer aus dem öffentlichen Leben heraushalten; doch noch weniger kann einem Machthaber kann daran gelegen sein, sie zu seinem Rivalen aufzubauen. Und so hat Kemal Atatürk wohl das Kalifat abgeschafft, aber auch das Religions-ministerium gegründet. Auch Zafer Şenocak politisiert ja in Glaubensdingen, wenn auch in anderer Richtung als Erdogan.
Eine Geschichte von vierzehn Jahrhunderten lässt sich nicht rückwirkend umschreiben. Auch nicht dies, dass in keinem muslimisch besiedelten Gebiet sich bis heute eine wirkliche Nation hat ausbilden können, so dass der Islam von jedem Demagogen als Identitätsstifter in Anspruch genommen werden kann.
In dem Punkt hat die Türkei einen Vorzug gegenüber den anderen muslimischen Völkern, und der liegt ausge-rechnet in einem ihrer wundesten Punkte: der Massenauswanderung nach Deutschland.
Dieser Tage hören wir, es müsse verhindert werden, dass die inneren Konflikte der Türkei auf deutschem Boden ausgetragen werden. Sie sollte sich das vermeiden lassen? Unter den in Deutschland lebenden Türken sind rund ein Drittel Kurden. Das hat sich auch nicht unterm Deckel halten lassen. Das nachhaltige kurdische Nationalpro-blem war der Hauptgrund für das Aufkommen eines politischen Islamismus in der kemalistischen Republik. Dass Zafer Şenocak kein Wort darüber verliert, ist kein gutes Zeichen, und nicht einmal, wo er von einer "überbrückenden Sprache" redet, erinnert er sich, dass die Muttersprache von Millionen Türken eben nicht Türkisch ist.
Das ist ein wunder Punkt, aber noch nicht der wundeste. Die große Masse der Türken in Deutschland bildet hier eine nationale Minderheit, aber keine autochthone, sondern als Außenposten eines fremden Staates, in dem sie sich ebenso oder mehr zu Hause fühlen als hier. Hier in einem Gastland, zu dem weder sie alle noch auch nur ihre Elite eine historische und kulturelle Verbindung haben! Inder, Pakistaner und Westindier in Großbritan-nien, Nord- und Schwarzafrikaner in Frankreich verbindet mit dem Land, in dem sie leben, eine lange Kolonialge-schichte, die noch immer für böses Blut sorgen mag, aber auf beiden Seiten ein Teil der jeweiligen Identität bildet; einen gemeinsamen Teil. Das Zusammenleben der Ethnien ist schon in diesen Ländern, wo die Minder-heiten eine Brücke bilden könnten und in den Bildungseliten tatsächlich bilden, prekär genug. Doch ein Großteil der Türken in Deutschland spricht nicht einmal die Sprache der Deutschen, und man hat den Eindruck, als habe die Fremdheit in vergangenen Jahrzehnt eher zu- als abgenommen.
Und da ist Erdogans coup d'état permanent - so nannte Fr. Mitterand den Regierungsstil des General de Gaulle - womöglich ein Geschenk der Geschichte. Deutschland mit seiner millionenfachen türkischsprachigen Leser-schaft wird ganz selbstverständlich zur Rückzugsbasis der türkischen Presse- und Gedankenfreiheit werden, hier herrscht Vereinsfreiheit und ist die türkische Population groß genug, ein diversifiziertes politisches Leben zu nähren und zu unterhalten. Mit andern Worten, wenn Erdogan so weitermacht, dann wird es eine historisch-kulturelle Verbindung zwischen der Türkei und Deutschland geben, und Erdogan wird es noch bedauern.
Während bislang die türkische Minderheit in Deutschland ein weltweites Unikum darstellte, wird sie dann - erst recht ein weltweites Unikum sein.
JE
Die Fortschritte des Atheismus bei den Arabern.
Atheismus im Mittleren Osten
Eine postislamistische Generation?
Die
arabischen Aufstände scheinen gescheitert – und die radikalen
Islamisten die Gewinner. Tatsächlich aber haben die Revolten von 2011
eine Bewegung freigesetzt, die vielfach unbemerkt blieb: die Hinwendung
zum Atheismus. Dessen Anhänger sind dem «Islamischen Staat» zahlenmässig
sogar weit überlegen.
von Mona Sarkis
2014 befragte die Al-Azhar-Universität, Ägyptens wichtigste religiöse Institution, 6000 Bürger und kam zum Ergebnis: 12,3 Prozent von ihnen sind Atheisten. 2012befragte das renommierte Marktforschungsinstitut Win/Gallup International 502 Saudiaraber und kam zum Ergebnis: 19 Prozent von ihnen sind «nicht religiös», weitere fünf Prozent gar überzeugte Atheisten. Vorausgesetzt, dass diese Zahlen repräsentativ sind, hiesse das: Fast ein Viertel der rund 29 Millionen Saudis ist latent oder akut religionsmüde. Und das ausgerechnet in dem Land, das die heiligsten Stätten des Islam hütet und dessen Herrscherhaus seit 1744 seine gesamte Raison d'être auf einem fundamentalistischen Religionsverständnis aufbaut.
Höllenpredigten statt Argumente
Wie gross der von Win/Gallup konstatierte Sündenfall demnach ist, beweist nichts besser als Riads Reaktion: Im März erklärte es die Infragestellung der islamischen Fundamente Saudiarabiens zum «terroristischen Akt». Weniger radikal, aber nicht minder konfus fiel die Reaktion Kairos aus: Eine nationale Kampagne soll die verlorenen Schafe – die gemäss Verfassung kriminell und mit Haft zu bestrafen sind – wieder in den Schoss der Gesellschaft holen. Das Problem ist nur: Keiner weiss, wie. Denn um die Dialoge, zu denen aufgerufen und eingeladen wird, fruchten zu lassen, müssten die Religionsgelehrten die Intelligenz der jungen Zweifler ansprechen. Gerade das aber misslingt ihnen zumeist. «Das Gros von ihnen hat nie gelernt, logische Fragen zu stellen, geschweige denn, solche zu beantworten», erklärt die 22-jährige Ägypterin Aynur. Stattdessen schwinge der Klerus vorzugsweise die Keule buchstabentreuer Gottesfurcht und traktiere seine Kritiker mit Szenarien von Höllenfeuern. «Allerdings wirkt das neben all dem, was wir hier wirklich durchmachen, irgendwann ausgesprochen lächerlich», meint Aynur.
Wie viele andere Muslime fühlte sich die junge Frau von Fragen umgetrieben: «Es ist also aus religiöser Sicht gut, eine Frau wegen Ehebruchs zu steinigen – aber einen 70-Jährigen, der eine 10-Jährige heiratet, soll man beglückwünschen?!» Oder: «Gott gab den Homosexuellen Instinkte – verbietet ihnen aber, diese auszuleben. Wozu gab er sie ihnen dann? Um sie zu quälen?» Oder: «Wenn Gott und Mensch zwei voneinander getrennte Entitäten sind, muss Gott doch räumlich begrenzt sein? Sonst könnte er ja in den Menschen einfliessen – womit Gott und Mensch eins wären.»
- Der Islam gehört nicht zu Europa.
- Vorurteile gegen den Islam?
- Arabische Aufklärung?
- Eine Religion der Beliebigkeit.
Artikuliert werden solche Fragen und Ideen vor allem in den sozialen Netzwerken. Über 70 arabisch- und englischsprachige Facebook-Seiten mit atheistischen Inhalten verzeichnet der Islamwissenschafter Rüdiger Lohlker von der Universität Wien 2013 in einem Überblick. Die Autoren seien Jordanier oder Sudanesen, Palästinenser oder Marokkaner, Kuwaiter oder Libyer, mit einer Follower-Gemeinde von acht («Die Atheisten Omans») bis 28 000 («Syrische Atheisten»). Dass diese Seiten nahezu alle seit 2011 entstanden sind, ist zweifellos den arabischen Revolten geschuldet, die Menschenrechte und persönliche Freiheit grossschrieben. Anderseits aber brachte der damalige Umbruch nur ans Licht, was schon lange gegärt hatte. Entsprechend lassen sich im arabischsprachigen Internet atheistische Themen finden, die bereits in der voraufgehenden Dekade gepostet wurden. Dies ist nicht weiter verwunderlich: Gerade in jenem Jahrzehnt kamen zwei Faktoren zusammen, welche die Entwicklung des Atheismus im Mittleren Osten verstärkten und beschleunigten. Als Erstes wäre das Internet zu nennen, das um die Jahrtausendwende in die Region einzog und quasi die Revolution vor der Revolution einleitete: Von den Schriften muslimischer Freidenker des Mittelalters über den Werdegang des schillernden einstigen Salafisten Abdullah al-Qasimi (1907 bis 1996) bis hin zu den Ansichten Che Guevaras oder des US-Nobelpreisträgers Richard Feynman waren plötzlich alle erdenklichen Informationen zugänglich und wurden regelrecht verschlungen.
Dass das Bedürfnis, andere Weltsichten kennenzulernen, aber überhaupt so gross war, ist wohl weniger der Globalisierung zuzuschreiben als vielmehr der Eskalation des politischen Islam, die in der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts unübersehbar wurde. Dabei galt diese Ideologie in den 1980er Jahren noch als Wunderwaffe der Muslime nach einer schier endlosen Kette von Niederlagen. Vor allem der Sieg Israels im Sechstagekrieg von 1967 hatte die Entwicklung eingeläutet: Weil damals der Panarabismus kollabierte, der die Massen mit Stolz – und offensichtlich überzogenen Erwartungen – erfüllt hatte, suchte man einen anderen geistigen Rettungsanker. Die Reislamisierung begann, längst abgelegte Kleidungsstücke wie das Kopftuch kamen wieder in Mode – aber die beschworene «Stärke der Umma», der islamischen Gemeinde, war damit noch nicht bewiesen.
Dies gelang erst den Mujahedin der achtziger Jahre, die die Sowjets aus Afghanistan vertrieben und so aller Welt demonstrierten, dass die Kombination aus extremer Religiosität und politischem Willen sehr wohl handfeste Siege erringen kann. In den folgenden Jahrzehnten zeitigte das Konzept allerdings Auswüchse, die immer mehr Muslime abstiessen. «Das Wort Gott ist für mich Synonym für Rückwärtsgewandtheit, Grausamkeit, Rassismus und Mordgier», notierte ein junger Muslim 2007 in Reaktion auf die Anschläge der Kaida im Irak. Die Gewaltexzesse des Islamischen Staats lagen damals noch jenseits des Vorstellbaren.
Der Islam ist nicht länger «die Lösung»
Noch wenn man vom pervertierten Glaubens- und Gesellschaftsverständnis solcher Extremisten absieht, bleibt die Frage, was der politische Islam eigentlich je geleistet hat. Die Antwort darauf blieben 2012 auch die Muslimbrüder schuldig – ihrer Parole «Der Islam ist die Lösung» zum Trotz. «Viele Ägypter hatten nach Hosni Mubaraks Sturz auf die Bruderschaft gehofft. Sie, die selbst jahrzehntelang unterdrückt worden war, sollte die Antithese zu Korruption und Gewaltherrschaft sein. Aber sie entpuppte sich bloss als eine weitere Synthese», resümiert Aynur.
Die Einsicht, dass der bisher praktizierte politische Islam in die Irre, aber nicht aus dem Abseits führt, beginnt auch dort Fuss zu fassen, wo man es zuletzt erwartet hätte. So sorgte der saudische Scharia-Gelehrte und ehemalige Salafist Abdullah al-Maliki 2011 mit einem Buch für Aufsehen, in dem er den Schlachtruf «Der Islam ist die Lösung» in «Die Souveränität der Umma ist die Lösung» abwandelte. Seine These: Die Revolten seien ausgebrochen, damit die Herrschaft der Individuen, Sippen oder Einzelparteien ende und das Volk Referenzpunkt der Legislative werde. Zwar bleibt für Maliki die Scharia der Dreh- und Angelpunkt der Verfassung, doch über die Art ihrer Anwendung soll einzig der Urnengang des Volkes entscheiden. So verschwommen seine These auch noch klingt: Sie ist ein Plädoyer für ein demokratisches Modell. Und aus dem Mund eines einstigen Ultrakonservativen, der obendrein noch in Saudiarabien lebt, ist das nicht wenig.
Fürs Erste, befindet der Syrer Fadi, sei es sogar mehr als genug. Dies überrascht, da der 36-Jährige an sich bekennender Atheist ist. Dennoch hält der Computeringenieur aus Homs es für fatal, die Religion aus lauter Frustration über ihren Missbrauch durch Machtmenschen über Bord zu werfen. Fadis Argumentation ist dabei keineswegs kulturhistorisch, sondern überaus pragmatisch ausgerichtet: Seit 1967 sei der Islam nachgerade zur identitätsstiftenden Konstituente aufgebaut worden. Ihn jetzt unreflektiert abschütteln zu wollen, hiesse, ein Vakuum zu schaffen, das nicht die Souveränität der Völker, sondern den nächsten Absturz bringe.
Extreme statt Synthese
Tatsächlich mag die Hinwendung zum Säkularismus oder gar Atheismus vorab denjenigen Muslimen leichtfallen, die sich im Internet bewegen und möglicherweise auch Auslanderfahrung haben. Für die meisten aber wäre für eine derartige Entwicklung zumindest ein Bruchteil jener Zeit vonnöten, die etwa die europäische Aufklärung beansprucht hat. Genau das aber scheint unmöglich: Seit vier Jahren überschlagen sich die Ereignisse, treten die Extreme immer schärfer hervor. Der Soziologe Asef Bayat von der Universität Illinois bleibt indes zuversichtlich und prognostiziert den «Postislamismus» – ein System, in dem radikale religiöse Lesarten schrittweise zugunsten einer Fusion mit zivilen Freiheiten aufgegeben werden. Eine solche Entwicklung wäre zu begrüssen; klar bleibt aber vorerst nur: Die ideologischen Kontinentalplatten des Mittleren Ostens reiben derzeit gewaltig aneinander.
Nota. - Wie praktisch für eine Religion, wenn sie eine heilige Kirche hat und eine gesalbte Priesterschaft! Die sind nämlich nur solange Hüter der dogmatischen Reinheit, wie... sie es sich leisten können. Alles oder nichts ist ihre Devise nur, solange Alles "machbar" bleibt. Wenn nicht, nehmen sie eher mit der Hälfte vorlieb, als sich auf Null setzen zu lassen; so viele Mäuler wollen gestopft, so viele Anliegen berücksichtigt sein!
Kirche und Klerus sind von Natur Pragmatiker, sie werden irgendwie für ihr Überleben sorgen - und für das der Religion. Als im aufgeklärten 18. Jahrhundert unter den Gebildeten der Deismus Mode wurde, dem zufolge GOtt zwar die Welt erschaffen, sich hernach aber zur Ruhe begeben hatte, da ereiferten sich die Krichenmänner und nannten es einen Atheismus-light. Am Ende des Jahrhunderts erlebten sie aber, wie man auf ihre Dienste ganz verzichtete und nur noch ein Höheres Wesen, womöglich sogar bloß Die Vernunft verehrte, und viele von ihnen aufs Schafott schickte. Da kehrten sie sich in das Unvermeidliche. Das Abendland wurde säkular, das Gewissen frei und die Menschenrechte fast schon selbstverständlich. Die Kirchen mussten den Gürtel enger schnallen, aber schlecht geht es ihnen noch heute nicht. Und viele Menschen sind noch immer froh, dass es sie gibt.
So sarkastisch es klingt: Der Islam hat eine solche Rückzugslinie nicht. Wenn er gegen die Säkularisierung bestehen will - als Glaube ohne bestimmten Inhalt einerseits und doch andererseits als kleinliches Regelwerk für den Alltag -, dann bleibt ihm als Rückzugsstellung überhaupt nur Alles! Der Salafismus, die Rückkehr zu den Ursprüngen und der Ausstieg aus der Geschichte ist der Islam mit dem Rücken zur Wand. Er hat eine blutige Gegenwart, aber keine Zukunft.
JE
Sunna und Schia.
Ein Heft der Vontobel-Schriftenreihe
Sunna und Schia
Der Nahe Osten ist in Aufruhr. Ein Vontobel-Heft der deutschen Islamwissenschafterin Katajun Amirpur beleuchtet die historischen und heutigen Konfliktfelder zwischen Schiiten und Sunniten.
Der Nahe Osten ist in Aufruhr. Ein Vontobel-Heft der deutschen Islamwissenschafterin Katajun Amirpur beleuchtet die historischen und heutigen Konfliktfelder zwischen Schiiten und Sunniten.
von Christian H. Meier
Der Anspruch der Vontobel-Stiftung, mit ihrer Schriftenreihe «aktuelle und grundlegende Themen» aufzugreifen, ist im vorliegenden Band zweifellos gleichermassen erfüllt: Das Heft «Schia gegen Sunna. Sunna gegen Schia» der Islamwissenschafterin Katajun Amirpur erscheint in einer Phase, in der die Spannungen zwischen den beiden grossen islamischen Konfessionen wieder das Niveau eines verdeckten oder sogar offenen Religionskriegs zu erreichen scheinen. In Syrien spielen sunnitische Jihadisten eine zentrale Rolle im Kampf gegen das - zumindest nach oberflächlicher Betrachtung - schiitische Alawitenregime der Asads; in Pakistan wiederum, aber beispielsweise auch in Ägypten sind Schiiten Stimmungsmache und Gewalt ausgesetzt, und auf regionaler Ebene kämpfen die streng antischiitische Wahhabiten-Monarchie Saudiarabien und der revolutionär-schiitische Iran um die Vormachtstellung im Nahen Osten, inklusive verschiedener Stellvertreterkonflikte.
Dass nicht alle diese Konflikte - selbst wenn es so scheinen mag - originär mit der Glaubensrichtung zusammenhängen, schreibt Amirpur selbst: Insbesondere im Falle Iran contra Saudiarabien «lässt sich kaum sagen und auseinanderhalten, was wen oder wer was beeinflusst: Politik oder Religion». Gleichzeitig - und dies zu verdeutlichen, ist das grösste Plus ihrer Abhandlung - hängen entscheidende Differenzen, etwa was Auffassungen von Macht und Autorität betrifft, eben doch auch mit den unterschiedlichen theologischen Wegen zusammen, die Schiiten und Sunniten genommen haben, seit sich in frühislamischer Zeit - bezeichnenderweise aufgrund politischer Streitpunkte - erstmals unterschiedliche Fraktionen bildeten. So spielt der Klerus im schiitischen Islam - dem weltweit schätzungsweise 15 Prozent aller Muslime folgen - eine viel stärkere Rolle als bei den Sunniten, und im Zuge verschiedener Neuinterpretationen ist es iranischen Gelehrten gelungen, diese theologische Bedeutung in politische Ansprüche umzumünzen - in Khomeinys Konzept von der «Herrschaft des Rechtsgelehrten».
Immer wenn die Konsequenzen fundamentaler Differenzen zwischen Sunna und Schia analysiert und jeweils mit historischen Entwicklungen verknüpft werden, ist Amirpurs Darstellung stark: etwa wenn sie die Genese der quietistischen «Jammer-Schia» und der aktivistischen «roten Schia» beschreibt. Die titelgebende Idee, interkonfessionelle Zusammenhänge und Konfrontationen zu beleuchten, hätte jedoch noch konsequenter erfolgen müssen. Die sunnitisch-schiitische Ökumenebewegung des 20. Jahrhunderts etwa wäre ausführlicherer Erwähnung wert gewesen. Auch die Alltagsebene fehlt weitgehend - wie gestaltet sich beispielsweise das Zusammenleben im multikonfessionellen Libanon? Insbesondere in der ersten Hälfte, einem historischen Schnelldurchlauf, überzeugt die Darstellung nicht immer, und insgesamt erfährt der Leser weit mehr über Schiiten als über Sunniten, was an der Spezialisierung der Autorin liegen mag. Rätselhaft bleibt schliesslich auch, warum ein - hochinteressantes - Kapitel über schiitische Minderheiten und gegenwärtige politische Konflikte mit «Sunnitische Vielfalt» überschrieben ist. Letztlich zeigt das Heft vor allem eines: Die Zusammenhänge zwischen Sunna und Schia sind komplex, immer wieder aktuell - und aus diesem Grund auf knapp 80 Seiten bei weitem nicht erschöpfend zu behandeln.
Katajun Amirpur: Schia gegen Sunna. Sunna gegen Schia. Schriftenreihe der Vontobel-Stiftung, Nr. 2070. Unentgeltlich zu beziehen unter www.vontobel-stiftung.ch oder bei Vontobel-Stiftung, Schriftenreihe, Tödistrasse 17, 8002 Zürich.
Die Islamisierung Ägyptens nach Mohammeds Tod..
 J. L. Gérôme, Gebet in Kairo
J. L. Gérôme, Gebet in Kairo
Die Buchhaltung des Kalifats
Im Keller der Hofburg lagern Tausende Schriften, die von
der Frühzeit des Islams erzählen. Wien ist heute das Zentrum der
Papyrusforschung – was längst nicht mehr nur Fachleute interessiert.
Es gibt ungelöste Rätsel, die auch nach fast eineinhalb Jahrtausenden noch
Brisanz besitzen. Wie konnten etwa die Araber nach dem Tod des Propheten Mohammed im 7.
Jahrhundert in kürzester Zeit das Perserreich erobern, Nordafrika überrollen und die Iberische
Halbinsel einnehmen? Wie funktionierte das Kalifat, auf das sich auch die Terrororganisation
"Islamischer Staat" heute bezieht? Und war der Islam ursprünglich gar eine Art ökumeni- sche
Bewegung, in der Juden, Christen und Anhänger Mohammeds in einer Gemeinschaft miteinander
lebten? Generationen von Historikern arbeiteten über diese Fragen, und doch bleibt vieles bis
heute dunkel. Nun blicken Islamforscher hoffnungsvoll nach Wien. Denn in der Wiener Hofburg,
in der Österreichischen Nationalbiblio- thek (ÖNB), könnten neue Antworten liegen.
In einem
Kellergewölbe hinter mehreren alarmgesicherten Türen lagern rund 180.000
Papyri aus mehreren Jahrtausenden, fast alle davon stammen aus Ägypten
aus der Zeit kurz nach der arabischen Eroberung, die größte Sammlung
der Welt. Es sind Texte aus dem Alltag, Pacht- und Eheverträge,
Verwaltungskorresponden- zen oder Abmachungen über Darlehen. Sie erzählen
Geschichten über das tägliche Leben der Menschen in dieser Umbruchszeit,
über ihre Sorgen und Nöte. Die New Yorker Mellon-Stiftung finanziert
seit einigen Jahren mit insgesamt rund 1,5 Millionen Euro die
Digitalisierung der relevantesten Dokumente. Ein riesiges Vorhaben, mit
dem das verborgene Archiv für Forscher auf der ganzen Welt zugänglich
gemacht werden soll. Denn die Schriften von damals sind auch für den
Islam von heute wichtig.
Wie gefragt die
Wiener Papyrusforscher sind, merkt, wer sie in der Hofburg besucht.
Bernhard Palme hat sein ganzes Leben mit den alten Dokumenten verbracht,
er ist Professor für Alte Geschichte an der Universität Wien und leitet
die Papyrussammlung. Der Mann mit dem gezwirbelten Schnurrbart wirkt
gehetzt und hin- und hergerissen. Jeder will etwas von ihm. Im Foyer
sitzen zwei italienische Studentinnen, die sechs Monate lang als
Stipendiatinnen hier arbeiten werden. Am Empfang ist eine Professorin
aus Algerien aufgetaucht. Sie möchte die berühmten Papyri einsehen, am
liebsten gleich 20 Stück auf einmal. Palme rennt die Treppen hinauf,
stolpert, und während er sich aufrappelt, läutet auch noch das Handy.
So geht es hier
mittlerweile ständig zu. Aus dem verschmähten Orchideenfach wurde eine
politische Wissen- schaft. Was Islamforscher, Arabisten oder Papyrologen
über die Frühzeit des Islams zu sagen haben, interessiert längst weit
mehr als nur den Kollegenkreis. Der ist ohnehin begrenzt. Nur rund 30
Menschen auf der Welt beschäftigen sich professionell mit der Edition
von Papyri.
"Dass wir plötzlich
so im Zentrum stehen, war wirklich nicht vorherzusehen", sagt Palme und
lacht, "im Jahr 2001 fragte der damalige Finanzminister Grasser
öffentlich, wozu es die Orientalistik an der Uni brauche. Zwei Wochen
später waren die Anschläge vom 11. September, und plötzlich
interessierten sich alle dafür."
Mit dem
neuen Jahrtausend setzte auch eine Renaissance der Erforschung
arabischer Papyri ein. Man erkannte, dass ihr Potenzial als Quellen
längst nicht ausgeschöpft war. Ihre Auswertung und Interpretation bleibt
aber eine herausfordernde Balance zwischen wissenschaftlicher
Gründlichkeit und gesellschaftlicher Verantwortung.
Das erfährt Lucian
Reinfandt in seiner Arbeit. Er arbeitet in der Papyrussammlung, sitzt
mittlerweile regelmäßig auf Podien und diskutiert mit Vertretern von
Islamverbänden die Ergebnisse seiner Arbeit. Was glaubten die frühen
Anhänger Mohammeds, und wie lebten sie? Die Debatte gilt es mit Umsicht
zu führen, sagt Reinfandt, "wir müssen in unserer Forschung ein großes
Maß an interkultureller Sensibilität aufbringen."
Dass Wien zum Zentrum der Papyrusforschung wurde, ist Zufall.
Ein Wiener Antiquitätenhändler fand in den 1880er Jahren in einer
Oasenlandschaft südlich von Kairo mehr oder weniger zwischen Abfall
antiker Siedlun- gen alte Papyri und schickte einige davon nach Wien.
Josef von Karabacek, der damalige Professor für orientalische Sprachen
an der Universität, erkannte, welchen Schatz er in Händen hielt.
Erzherzog Rainer, ein Förderer der Wissenschaft, kaufte so viel auf, wie
er konnte: Ägyptische Totenbücher aus dem 2. Jahrtausend vor Christus,
koptische Bauernkalender oder die älteste Partitur der Welt, ein Lied
mit Musiknoten aus der Tragödie
Orestes
von Euripides. 4.000 Jahre Kulturgeschichte kamen so nach Wien.
Im Jahr 1899 schenkte Erzherzog Rainer die Sammlung Kaiser Franz Josef
zum Geburtstag – ein Glücksfall, denn so blieb sie zusammen und wurde
nicht in alle Winde verstreut.
"Diese Sammlung ist unglaublich wichtig für uns"
Heute liegen die Papyri
auf Hunderte Schachteln verteilt im Keller der Hofburg, gelagert bei 19
Grad Celsius und geschützt vor Sonnenlicht. Sie zu restaurieren und
inhaltlich zu erschließen ist ein langwieriger Prozess. Für ungeübte
Augen sehen sie oft eher aus wie ein kleiner Haufen Dreck. Für die
Forscher ist es ein gigantisches Puzzlespiel. Mal fehlt ein großes
Stück, mal sind nur wenige Wörter darauf zu lesen – doch gerade die
können interessant sein. Systematisch wird das riesige Archiv derzeit
durchforstet, jeder Papyrus studiert und in Klassen eingeteilt, von gut
erhaltenen Stücken mit relevantem Inhalt bis zu uninteressanten, die
unbearbeitet wieder in den Keller wandern.
Sensationsfunde
gab es immer wieder. Zuletzt hat der Papyrologe Federico Morelli ein
zusammengehöriges Dossier gefunden, Briefe unter hohen
Verwaltungsbeamten kurz nach der Eroberung Ägyptens. Die Texte erzählen
über den Umbruch, als die Macht am Nil von den Byzantinern auf die
Araber überging. Die neuen Herrscher vermieden Übergriffe auf die
Zivilbevölkerung. Sie übernahmen die bestehenden Verwaltungsstruktu- ren
und ließen ihren Untertanen viele Freiheiten. "Man erfährt in diesen
Texten viel über die Beziehungen zwischen einheimischen Christen und
Arabern", erzählt der Italiener Morelli. "Die Religion kommt aber kaum
vor. Bis in das achte Jahrhundert stellen christliche Beamte ein Kreuz
an den Beginn vieler Briefe, das war überhaupt kein Problem." Der Islam
habe sich gegen Heiden gerichtet, aber nicht gegen Juden und Christen.
Eine Islamisierung Ägyptens habe erst später und langsam stattgefunden
und wurde nicht mit Gewalt erzwungen. "Aus meiner Sicht spielten bei
vielen Konvertierungen steuerliche Gründe eher eine Rolle als
religiöse", sagt Morelli, "Christen und Juden mussten nämlich höhere
Abgaben bezahlen."
Wie viele Dokumente
zum sogenannten Morelli-Archiv gehören, weiß derzeit noch keiner. 100
bis 150 sind es derzeit. Federico Morelli könnte sein gesamtes
restliches Forscherleben mit dem Fund verbringen. Denn in Wien liegen
wohl Hunderte weitere, möglicherweise finden sich auch in anderen
Archiven, in London, Straßburg oder New York noch Papyri, die zu dem
Konvolut gehören.
Fred Donner von der
Universität Chicago ist einer der führenden Wissenschaftler für die
Geschichte des frühen Islams – und hat einige der umstrittensten Thesen
aufgestellt, unter anderem jene, der Islam sei in seiner Anfangszeit
eine Art Ökumene gewesen. Belege dafür sind spärlich. Auch er hofft auf
die Papyri in Wien. "Diese Sammlung ist unglaublich wichtig für uns",
sagt Donner. Die Dokumente beschreiben eine Zeit, über die noch wenig
bekannt ist. Wie wurde die religiöse Lehre ausgelegt, wie wurden
Begriffe benutzt. "Es wäre etwa großartig, wenn wir ein Papyrus finden,
in dem einer der frühen Anhängern des Islams über den Dschihad schreibt
und erklärt, was er darunter versteht, was er für sein Leben bedeutet",
sagt Donner.
Die
Papyrologie und die Arabistik florieren. Das liegt auch am allgemeinen
Interesse, das Islam und Islamwissenschaften seit 2001 auf sich ziehen.
Wissenschaftler aus der ganzen Welt pilgern nach Wien, durch das
Papyrusmuseum schieben sich jeden Tag Schulklassen. Es gibt
Forschungsgelder und Aufmerksamkeit in Zeiten von Sicherheits- und
Integrationsdebatten. "Wir haben von diesem Interesse profitiert, für
das Fach ist es von Nutzen", sagt Lucian Reinfandt. Doch man dürfe sich
beim Islam nicht nur auf Fragen wie den Dschihad beschränken. Es gebe
mehr, das man erzählen müsse, sagt er, "die arabische Dichtung und ihre
Geschichten etwa. Wir müssen die Kultur in ihrer ganzen Breite und Würde
zeigen."
Nota. -
Im Kalitfat von Cordoba und in den maurischen Nachfolgestaaten wurden
im Lauf der Jahrhunderte immer wieder Gesetze erlassen, die es Christen
und Juden erschweren sollten, zum Islam zu konvertieren, um Steuern zu
sparen. Moslem wird man, indem man den rechten Zeigefinger hebt und
sagt: "Es gibt keinen Gott außer Gott, und Mohammed ist sein Prophet",
das ist alles. Dann musste man im islamischen Staat nur den zakât entrichten,
die Spende für Arme, Witwen und Waisen. Vom Staat selbst besteuert
wurden dagegen die anderen 'Religionen des Buchs'; heidnische
Götzendiener freilich wurden verfolgt.
Es
ist begreiflich, dass der Islam zunächst als eine monotheistische
Ökumene erscheinen konnte. Noch als Tarik von rivalisierenden
westgotische Kronprätendenten nach Spanien gerufen wurde, hielt mandie
Anhänger Mohammeds für ein vielen verfeindeten christologischen Sekten
im Osten. Tatsächlich fällt es dem
Außenste- henden bis heute schwer, im Koran spezifische Glaubensinhalte
auszumachen. Sunna und Shia unterscheiden sich politisch und nicht
theologisch, und so alle andern muslimischen Glaubensrichtungen.
Die
Ausbreitung des Kalifats geschah als militärisch-politische
Machtübernahme; das Volk nahm daran keinen Anteil. An der Verbreitung
des Glaubens war der winzigen arabischen Erobererschicht nicht gelegen,
sie hätte ihre Sonderstellung beeinträchtigt. Und in fiskalischer
Hinsicht war dem islamischen Staat an der Vermehrung von Juden und
Christen mehr gelegen als an deren Bekehrung. Die religiöse Toleranz,
die dem frühern Islam nachgesagt wird, follgte lediglich dem Primat der
Politik.
JE .
Nicht die Not, sondern der Überfluss.
Die Weltreligionen erwuchsen aus einem neuen Überfluss
Nicht politisch komplexe Gesellschaftsstrukturen, sondern materielle Sicherheit ließen die großen Religionen entstehen
Paris - Die Wurzeln der Weltreligionen, wie wir sie heute kennen, reichen weit in die Zeit zurück. Buddhismus, Islam, Hinduismus, Judaismus und damit auch das Christentum basieren auf einem Spiritualismus, auf asketischen Lebensregeln und moralischen Prinzipien, die unabhängig voneinander in drei unterschiedlichen Regionen Eurasiens auftraten. Dieses parallele Erblühen neuer religiöser Denkrichtungen wurde bedingt durch die Entstehung von großen, politisch komplexen Gesellschaften, so zumindest lautet die gängige Annahme. Eine Gruppe von Wissenschaftern sieht dies allerdings anders: Auf Basis eines komplizierten statistischen Modells, kombiniert mit historischen und psychologischen Daten, kamen sie zu dem Schluss, dass es der verbesserte Lebensstandard war, der den grundlegenden Wandel im Denken herbeführte.
Heute erscheint es selbstverständlich, dass Religion auf spirituellen und moralischen Ideen und Regeln basiert. Doch das war nicht immer so. Unter Jägern und Sammlern und frühen Stammesgesellschaften etwa drehte sich Religion vor allem um Rituale, Opfergaben, Tabus und Kulthandlungen, die Böses oder allgemeines Unglück abwehren sollten. Zwar findet man all das auch bei den heutigen Religionen mehr oder weniger ausgeprägt, doch kamen in der Zeit zwischen 500 und 300 vor unserer Zeitrechnung wesentliche Element neu dazu. Während dieser sogenannten Achsenzeit wurde unter anderem das Fundament der modernen religiösen Vorstellungen gelegt - und zwar unabhängig voneinander im östlichen Mittelmeergebiet, auf dem indischen Subkontinent und im heutigen Nordost-China.
Askese statt täglicher Kampf ums Überleben
"Die neuen Doktrinen, die damals entstanden, betonten erstmals die individuelle Fähigkeit zur 'persönlichen Transzendenz', also die Vorstellung, dass es für den Menschen unabhängig vom materiellen Erfolg einen Lebenssinn gibt", meint Nicolas Baumard von der Ecole Normale Supérieure in Paris. "Die Grundlagen liegen in moralischem Verhalten und die Kontrolle der eigenen materiellen Bedürfnisse durch Entsagung und mitfühlendes Handeln."
Bisher war der Großteil der Fachwelt der Meinung, große Gesellschaften bildeten diese moralisierenden Religionen heraus, weil das ihr Funktionieren wesentlich verbessern würde. Doch Baumard und seine Kollegen widersprechen und nennen das Alte Ägypten oder das römische Imperium als Gegenbeispiele. In diesen hochorganisierten Gesellschaften spielten vielfach quasi "nicht-moralische" Götter wichtige Rollen.
Im Rahmen ihrer Studie, die im Fachjournal "Current Biology" erschienen ist, kombinierten die Forscher statistische Methoden mit psychologischen Theorien, die auf Experimenten basieren. Es zeigte sich, dass erst ein gewisser Überfluss an Ressourcen, die unmittelbar lebenswichtig sind, zu den grundlegenden Veränderungen im Denken geführt hatte. Nach den Berechnungen der Wissenschafter kam es in den antiken Gesellschaften zu einem geradezu plötzlichen Erblühen neuer religiöser Denkrichtungen, sobald den einzelnen Mitgliedern eine tägliche Energieration von rund 20.000 Kilokalorien zur Verfügung stand. Etwa ab diesem Wert könne man von einer gewissen materiellen Existenzsicherheit sprechen, die auch eine Planung etwa der Nahrungsmittel- versorgung über die unmittelbare Zukunft hinaus ermöglichte, glaubt Baumard.
Neuer Seelenfriede
"Das mag zwar heute immer noch recht bescheiden klingen, doch damals war dieser 'Seelenfriede', der mit einem solchen Überfluss einhergeht, völlig neu", erklärt Baumard. "Die Menschen der Stammesgesellschaften, ja selbst der archaischen Großreiche, erlebten regelmäßige Hungersnöte und verheerende Seuchenausbrüche. Erst als während der Achsenzeit die Bevölkerung anwuchs und die Urbanisierungsrate stieg, brachen zumindest für einige Gesellschaftsschichten bessere Zeiten an."
Die Wissenschafter fanden Hinweise, dass dieser Übergang mit einem Wandel zusammenfällt, der von einer "schnellen", ausschließlich auf die unmittelbar Bedürfnisbefriedigung ausgerichtete Lebensweise zu einer Existenz führte, die auf längerfristige Investitionen ausgerichtet ist. (tberg)
Abstract
Current Biology: "Increased Affluence Explains the Emergence of Ascetic Wisdoms and Moralizing Religions"
Moralisierende Religionen und andere.
Launische Umwelt, strenge Götter
Unter
den tausenden Religionen, die es auf der Erde gibt, haben nur manche
Moralvorschriften. Die regieren dort, wo eine unwägbare Natur die Ernten
bedroht.
Wo
kommen die Götter her? Aus dem Mangel und der Not, antworten alle die,
die glauben, dass die Überirdischen von den Irdischen erfunden wurden:
„Worin anders als in den Schmerzen und Bedürfnissen der Menschen hat
dieses schmerzlose und bedürfnislose Wesen seinen Grund und Ursprung?
Nur im Elend der Menschen hat Gott seine Geburtsstätte.“ So formulierte
es der Philosoph Ludwig Feuerbach, er meinte es ganz breit – „das
Jenseits ist das Diesseits im Spiegel der Fantasie“ –, später verengten
es Sozialwissenschaftler dahin, ein gemeinsamer Glaube diene der
Koordination und dem Zusammenhalt einer Gruppe, dem schloss sich Richard
Dawkins aus evolutionsbiologischer Sicht an.
Die Religionen bzw. ihre Gläubigen ließen sich davon nicht beirren, es gibt hunderte, ja tausende, sie sind regional höchst unterschiedlich verteilt – Brasilien hat 159, Kanada 19, die Elfenbeinküste hat 76, Norwegen 13 –, es gibt zudem verschiedene Typen, grob zwei: In den einen lebten die Götter in irgendwelchen Himmeln – auf dem Olymp, in Walhall –, dort trugen sie auch Händel aus, die auf Menschen durchschlagen konnten; in verwandten Religionen lebten und leben die Götter – oder auch Geister – in der Natur, auch sie sind launisch und wollen mit Opfern besänftigt werden.
In den anderen hingegen herrschen keine subjektiven Befindlichkeiten, sondern strenge Regeln, die, wie die Götter selbst, durch Offenbarung auf die Menschen kamen, und für deren Einhaltung die Götter sorgen, mit Sintfluten etc. Das sind die uns vertrauten Götter, Frans Roes hat sie die „moralisierenden“ genannt und sie mit dem Wachstum von Gesellschaften in Zusammenhang gebracht: Das bringt die Gefahr von Zersplitterung, ihr wird mit sozialen Normen entgegengewirkt, die mit göttlicher Autorität gedeckt sind (Evolution and Human Behavior, 24, S. 126).
Diesen Ansatz hat nun Carlos Botero, Umweltkundler an der North Carolina State University, aufgenommen und bettet ihn im Vergleich von 389 erdweiten Gesellschaften in einen historischen und ökologischen Rahmen ein (Pnas, 10. 11.): Demnach haben Götter zum einen einen geografisch-kulturellen Hintergrund, benachbarte Völkerschaften und solche mit den gleichen Sprachwurzeln haben den gleichen Typ. Und zum anderen kamen sie aus ökologischen Gründen auf ihn, es ging um die Ernährung bzw. ihre Bedrohung: Dort, wo die Natur freigiebig ist, und Jäger und Sammler das ganze Jahr über nur zugreifen müssen – in Ostafrika, in Südamerika, auch an der Westküste Nordamerikas –, herrschen Götter, die keine Gebote erlassen haben, sie zeigen nur ihre Launen, in Naturkatastrophen etwa.
Götter mit Gesetzestafeln regieren vielmehr dort bzw. helfen dort beim Regieren, wo dem Boden und den Launen der Natur etwas abgewonnen werden musste – in Nordafrika etwa, Europa und dem Nahen Osten –, dort also, wo sich früh die Landwirtschaft durchsetzte. Die bringt viele Organisationsprobleme – von der Nachbarschaftshilfe beim Ernten über die Sicherung des Eigentums an Grund und Boden und Nutzvieh bis zur Bewässerung ganzer Zweistromländer –, die nur von komplexen Gesellschaften bewältigt werden konnten. Aller gesellschaftlichen Organisation zum Trotz war doch jede Ernte bedroht, von Fluten, von Dürren, dann lehrte die Not zudem Beten.
Parallelfall: Vögel unter dem Himmel
„Die Wahrscheinlichkeit moralisierender Götter wächst dort, wo die Umwelt variabler und weniger vorhersehbar ist“, schließt Botero und verweist auf eine frappante Parallele: Seine Weltkarte der „moralisierenden Götter“ ist fast deckungsgleich mit einer, die Dustin Rubinstein (Columbia University) anno 2011 publizierte (Current Biology 21, S. 72): Er hat bei Vögeln die Kooperation beim Brüten kartiert, und auch sie, die nicht säen und nicht ernten, rücken dort zusammen – konkret, dort helfen Dritte den Brutpaaren bei der Aufzucht der Jungen –, wo eine unberechenbare Umwelt es empfiehlt bzw. erzwingt, in ebenden Regionen, in denen Menschen ihren Zusammenhalt mit „moralisierenden Göttern“ stärkten.
("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2014)
Die Religionen bzw. ihre Gläubigen ließen sich davon nicht beirren, es gibt hunderte, ja tausende, sie sind regional höchst unterschiedlich verteilt – Brasilien hat 159, Kanada 19, die Elfenbeinküste hat 76, Norwegen 13 –, es gibt zudem verschiedene Typen, grob zwei: In den einen lebten die Götter in irgendwelchen Himmeln – auf dem Olymp, in Walhall –, dort trugen sie auch Händel aus, die auf Menschen durchschlagen konnten; in verwandten Religionen lebten und leben die Götter – oder auch Geister – in der Natur, auch sie sind launisch und wollen mit Opfern besänftigt werden.
In den anderen hingegen herrschen keine subjektiven Befindlichkeiten, sondern strenge Regeln, die, wie die Götter selbst, durch Offenbarung auf die Menschen kamen, und für deren Einhaltung die Götter sorgen, mit Sintfluten etc. Das sind die uns vertrauten Götter, Frans Roes hat sie die „moralisierenden“ genannt und sie mit dem Wachstum von Gesellschaften in Zusammenhang gebracht: Das bringt die Gefahr von Zersplitterung, ihr wird mit sozialen Normen entgegengewirkt, die mit göttlicher Autorität gedeckt sind (Evolution and Human Behavior, 24, S. 126).
Diesen Ansatz hat nun Carlos Botero, Umweltkundler an der North Carolina State University, aufgenommen und bettet ihn im Vergleich von 389 erdweiten Gesellschaften in einen historischen und ökologischen Rahmen ein (Pnas, 10. 11.): Demnach haben Götter zum einen einen geografisch-kulturellen Hintergrund, benachbarte Völkerschaften und solche mit den gleichen Sprachwurzeln haben den gleichen Typ. Und zum anderen kamen sie aus ökologischen Gründen auf ihn, es ging um die Ernährung bzw. ihre Bedrohung: Dort, wo die Natur freigiebig ist, und Jäger und Sammler das ganze Jahr über nur zugreifen müssen – in Ostafrika, in Südamerika, auch an der Westküste Nordamerikas –, herrschen Götter, die keine Gebote erlassen haben, sie zeigen nur ihre Launen, in Naturkatastrophen etwa.
Götter mit Gesetzestafeln regieren vielmehr dort bzw. helfen dort beim Regieren, wo dem Boden und den Launen der Natur etwas abgewonnen werden musste – in Nordafrika etwa, Europa und dem Nahen Osten –, dort also, wo sich früh die Landwirtschaft durchsetzte. Die bringt viele Organisationsprobleme – von der Nachbarschaftshilfe beim Ernten über die Sicherung des Eigentums an Grund und Boden und Nutzvieh bis zur Bewässerung ganzer Zweistromländer –, die nur von komplexen Gesellschaften bewältigt werden konnten. Aller gesellschaftlichen Organisation zum Trotz war doch jede Ernte bedroht, von Fluten, von Dürren, dann lehrte die Not zudem Beten.
Parallelfall: Vögel unter dem Himmel
„Die Wahrscheinlichkeit moralisierender Götter wächst dort, wo die Umwelt variabler und weniger vorhersehbar ist“, schließt Botero und verweist auf eine frappante Parallele: Seine Weltkarte der „moralisierenden Götter“ ist fast deckungsgleich mit einer, die Dustin Rubinstein (Columbia University) anno 2011 publizierte (Current Biology 21, S. 72): Er hat bei Vögeln die Kooperation beim Brüten kartiert, und auch sie, die nicht säen und nicht ernten, rücken dort zusammen – konkret, dort helfen Dritte den Brutpaaren bei der Aufzucht der Jungen –, wo eine unberechenbare Umwelt es empfiehlt bzw. erzwingt, in ebenden Regionen, in denen Menschen ihren Zusammenhalt mit „moralisierenden Göttern“ stärkten.
("Die Presse", Print-Ausgabe, 11.11.2014)
aus scinexx mesoamerikanische Gottheit Tlaloc
In harter Umwelt sind die Götter strikt
Religionen und ihr Gottesbild werden von ökologischen und gesellschaftlichen Faktoren geprägt
Umwelt oder nur Kultur?
Warum sich die Religionen so unterschiedlich entwickelt haben, und welche Faktoren bestimmen, an was die Menschen glauben, beschäftigt Forscher verschiedenster Disziplinen schon seit langem. Wie auch bei anderen Verhaltensweisen wird dabei häufig debattiert, ob die natürliche Umwelt oder aber kulturelle Einflüsse den stärkeren Effekt haben. "Wir wollten all diese voreingenommenen Ansichten ignorieren und uns alle potenziellen Faktoren auf einmal anschauen", erklärt Erstautor Carlos Botero von der North Carolina State University in Raleigh.
Für ihre Studie untersuchten die Forscher den Glauben von 583 Gesellschaften aus allen Regionen der Erde und glichen sie mit den dort herrschenden historischen, sozialen und ökologischen Faktoren ab. Im Gegensatz zu früheren Studien erfassten sie dabei nicht nur grobe Schätzungen der ökologischen Bedingungen, sondern nutzten hochauflösende globale Datensätze, um Informationen über Umweltfaktoren wie Pflanzenwachstum, Niederschläge und Temperaturen zu erhalten. "Nachdem wir so viele andere Faktoren mit einbezogen hatten wie wir konnten, wollten wir wissen, ob sich trotzdem noch einen Einfluss der Umwelt feststellen ließ", sagt Botero.
Harsche Umwelt – striktere Götter
Das Ergebnis: "Wenn das Leben hart ist oder unsicher, dann glauben die Menschen an übermächtige Götter", berichtet Russell Gray von der University of Auckland. Demnach ist es kein Zufall, dass Judentum und Islam beide im Nahen Osten entstanden – in einer Region, in der Trockenheit und Wüsten schon früher das Überleben erschwerten. Bewohner der Tropen und des Regenwalds dagegen kennen solche strikten Religionen eher weniger.
"Obwohl manche Aspekte von Religionen auf den ersten Blick eher negativ escheinen, deutet die nahezu universelle Verbreitung solcher Glaubensformen darauf hin, dass es einen Vorteil bringen muss", sagt Gray. Im Falle der harschen Umwelten sei dieser relativ deutlich. Denn nach gängiger Theorie fördert der Glauben an ein höheres Wesen, das klare moralische Vorgaben macht, die Kooperation innerhalb einer Gesellschaft. "Und das prosoziale Verhalten hilft den Menschen dabei, in harten und unberechenbaren Umgebungen zu überdauern", so Gray.
Eigentum und politische Komplexität
Aber: Die Studie zeigt auch, dass Umwelt keineswegs alles ist. Stattdessen prägen auch gesellschaftliche und kulturelle Faktoren, ob eine Kultur an einen starken, moralischen Gott glaubt. So fördert auch eine politisch komplexe Gesellschaft mit verschiedenen Hierarchien und Gremien diese Religionsformen. Auch Gesellschaften, die privates Eigentum kennen und Viehzucht betreiben, neigen stärker zu strikteren Gottheiten, wie die Forscher berichten. Aus ihren Ergebnissen entwickelten sie ein Modell, mit dem sie anhand dieser Faktoren immerhin mit 91-protziger Genauigkeit
"Daraus ergibt sich ein Gesamtbild, nachdem Religion weder durch rein kulturelle Weitergabe entsteht, noch durch simplen ökologischen Determinismus", so die Forscher. "Stattdessen ergibt sie sich aus einer Kombination von historischen, sozialen und ökologischen Faktoren." Diese Wechselwirkungen und Faktoren zu kennen hilft ihrer Ansicht nach dabei, die Kräfte zu verstehen, die das Verhalten unserer Spezies geformt und geprägt haben. (Proceedings of the National Academy of Sciences, 2014; doi: 10.1073/pnas.1408701111)
(National Evolutionary Synthesis Center (NESCent), 11.11.2014 - NPO)





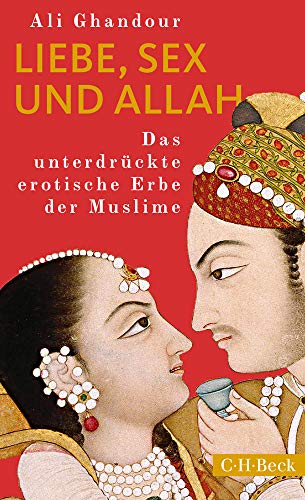













%2Bund%2Ban%2Bandere.%2BHellere%2BGrauschattierungen%2Bzeigen%2C%2Bwo%2Bweniger%2Bgutes%2BPflanzenwachstum%2Bherrscht.jpg)
Der Kommentar wurde von einem Blog-Administrator entfernt.
AntwortenLöschen