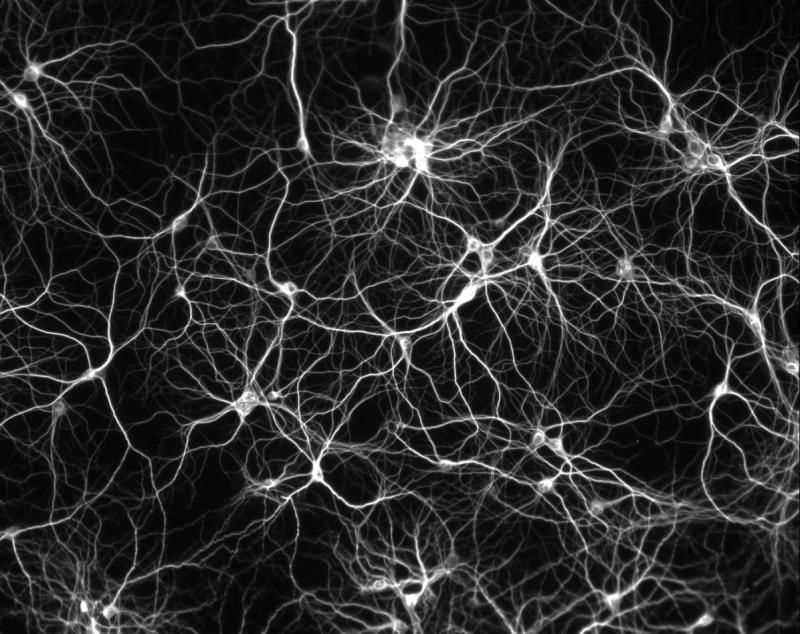Im August jährt sich zum hundertsten Mal der Ausbruch des Ersten Weltkriegs, die Zeitungen sind voll davon. Damals erinnerte sich wohl kaum jemand daran, dass sich im selben Moment zum hundertsten Mal der Wiener Kongress gejährt hatte - jenes diplomatische Großereignis, das das europäische Gleichgewicht geschaffen hatte, das der Weltkrieg ein für allemal zerstören sollte..
aus NZZ, 22. 3. 2014
Das Konzert der Grossen
Der Wiener Kongress, die Diplomatie und die Neugestaltung Europas vor zweihundert Jahren
von Paul Widmer
Von September 1814 bis Juni 1815 dauerte der
Wiener Kongress. Die Bilanz des Versuches, Europa nach Napoleons Abtritt
von der Bühne der Geschichte neu zu ordnen, fällt zwiespältig aus.
Vor hundert Jahren erschoss der
jugoslawische Nationalist Gavrilo Princip in Sarajevo das
österreichische Thronfolgerpaar. Diese Tat eines Gymnasiasten löste
enorme Kettenreaktionen aus, die in den Ersten Weltkrieg mündeten. Die
Millionen von Toten erschütterten das europäische Selbstverständnis und
rissen die Vorherrschaft des alten Kontinents mit sich ins Grab. Zu
Recht entsinnt man sich dieses Zentenariums. Aber man sollte den Blick
auch zweihundert Jahre zurückwerfen, auf den Wiener Kongress. Die beiden
Ereignisse stehen in einem inneren Zusammenhang. Damals wurde unter
schwierigsten Bedingungen eine Friedensordnung errichtet, die
Vorkommnisse wie den Grossen Krieg gerade hätte verhindern sollen. Rund
fünfzig Jahre lang gelang dies recht gut. Doch dann versagte die
Diplomatie zusehends. Die nationalistischen Kräfte gewannen die
Oberhand, und die europäischen Staatsmänner schlitterten sehenden Auges
in die Katastrophe.
Der Wiener Kongress war ein
diplomatisches Grossereignis. Noch nie waren so viele Fürsten
zusammengekommen, um direkt miteinander zu verhandeln. Alle folgten der
Einladung des Gastgebers, des österreichischen Kaisers Franz I.: Zar
Alexander I., der preussische König Friedrich Wilhelm III., der
britische Aussenminister Lord Castlereagh, der doppelzüngige Talleyrand
aus Paris; und es wimmelte von Fürsten und Gesandten aus den Mittel- und
Kleinstaaten, die die tonangebenden Vertreter der Grossmächte
umschwärmten. Die wichtigste Gestalt war indes nicht der Gastgeber,
sondern dessen Aussenminister Clemens Fürst von Metternich. Er führte
Regie - aus dem Büro, aber auch aus dem Boudoir.
Keine Konferenz wie heute
Der Wiener Kongress war keine
Konferenz, wie wir sie uns heute vorstellen. Nichts von einer
feierlichen Eröffnung mit allen Teilnehmerstaaten, nichts von geregelten
Plenarsitzungen unter der Leitung eines Präsidenten. Eine
Vollversammlung gab es nicht - ausser ganz am Schluss, als die meisten
Delegationen schon abgereist waren. Dafür traf man sich ständig zu
gesellschaftlichen Anlässen, schliesslich soll der Kongress ja ausgiebig
getanzt haben, und man antichambrierte nach allen Seiten. Was die
Knochenarbeit betraf, so delegierte man sie wie üblich an die
Ausschüsse. Die Statistische Kommission beispielsweise erstellte die
Grundlagen, welche zur Legitimation von Gebietsverschiebungen dienten.
Das ausschlaggebende Gremium war
ein Vierer- und später ein Fünferausschuss. Ihm gehörten die Grossmächte
Russland, Österreich, Preussen und England an, später auch Frankreich.
Obschon Kriegsverlierer, hatte es Talleyrand mit geschicktem Lavieren
verstanden, Frankreich schon nach drei Jahren auf dem Kongress zu Aachen
(1818) den Zugang zu diesem exklusiven Klub zu verschaffen. Niemand kam
- so der Altmeister der Geschichte der Neuzeit, Heinz Duchhardt, in
seinem vorzüglichen Buch «Der Wiener Kongress» (München 2013) - um
dieses «Entscheidungskartell» herum. Wer ein Anliegen hatte, musste
jemanden aus dem Kreis der Grossmächte gewinnen, damit dieser dort als
sein Anwalt auftrat. Die Vertreter der mittleren und kleineren Staaten
hatten höflichst vor der Tür zu warten.
Besonders erfolgreich im
Lobbyieren war die Genfer Delegation mit Charles Pictet de Rochemont an
der Spitze. Dieser Gentleman traf sich jeden Morgen um fünf mit Johannes
Graf Capo d'Istria, einem einflussreichen Berater des Zaren - was
übrigens auch beweist, dass einige Abgesandte nicht tanzten, sondern
hart arbeiteten. Dank den guten Beziehungen zur russischen Delegation
gelang es, die internationale Zustimmung zum Beitritt Genfs zur
Eidgenossenschaft zu erwirken, das Genfer Territorium auf Kosten
Frankreichs und Savoyens zu arrondieren und die Schweizer Neutralität
problemlos bestätigen zu lassen. Pictet verrichtete seine Arbeit so gut,
dass ihn die Tagsatzung, sobald Genf dem Bund beigetreten war, als
ihren Vertreter an die Zweite Pariser Friedenskonferenz entsandte.
Unschätzbare Dienste leistete auch der Waadtländer Gesandte Frédéric
César de Laharpe. Zar Alexander begegnete seinem ehemaligen Erzieher
immer noch mit Hochachtung und hegte für dessen Heimat eine
unerschütterliche Zuneigung.
Der Wiener Kongress verfolgte
einen Hauptzweck: Nach den Wirren der Französischen Revolution und den
Napoleonischen Kriegen sollte Europa wieder eine stabile Ordnung
erhalten. Die Fürsten wollten das vorrevolutionäre Europa auf der
Grundlage der Legitimität restaurieren. Das kam vornehmlich Frankreich
zustatten. Es wurde grosszügig behandelt. Ludwig XVIII. als legitimer
Herrscher über jene Nation, die Europa mit Kriegen überzogen hatte,
musste keine nennenswerten Gebiete abtreten, nicht einmal das Elsass.
Was für ein Unterschied zu den vom Geist der Revanche erfüllten
Versailler Friedensverträgen nach dem Ersten Weltkrieg!
Aber überall nahm man es mit dem
Prinzip der Legitimität nicht so genau. Viele deutsche Kleinststaaten
mussten über die Klinge springen. Auch die säkularisierten Territorien
wurden der Kirche nicht mehr zurückerstattet. Selbst so grosse
Republiken wie Venedig und Genua fanden keine Gnade. Über der polnischen
Frage gar entzweite sich der Kongress dermassen, dass man einen neuen
Waffengang befürchten musste. Je länger sich die Verhandlungen hinzogen,
umso mehr drohten die Teilnehmer das eigentliche Ziel aus den Augen zu
verlieren und sich in Teilfragen zu verheddern - ein typisch
multilaterales Syndrom. Doch da kam Hilfe von unerwarteter Seite.
Napoleon entfloh aus seiner Verbannung auf Elba, eroberte Frankreich
erneut im Sturm und versetzte die Diplomaten in Wien in Angst und
Schrecken. Angesichts der eminenten Gefahr verabschiedeten diese in
Windeseile im Juni 1815 die Kongressakte. Was man in der Hast nicht mehr
erledigen konnte, nahm man mit nach Paris und regelte es im Zweiten
Pariser Friedensvertrag (November 1815).
Grosses Pensum
Was die Diplomaten in Wien in neun
Monaten zustande brachten, ist erstaunlich. Die politische Landkarte
bekam ein neues Gesicht, vor allem in Deutschland und Norditalien sowie
im Osten mit den russischen, preussischen und österreichischen
Gebietserweiterungen. Dann machte der Kongress ein für alle Mal mit der
deutschen Kleinstaaterei Schluss. Nebenbei anerkannte er auch die
Neutralität der Schweiz. Und mit dem Deutschen Bund entstand an der
Grenze zu Frankreich ein Staatswesen, das genügend stark war, um
französischen Angriffen zu widerstehen, und genügend schwach, um selber
keinen Angriffskrieg führen zu können. Allerdings war der Bund ein recht
artifizielles Gebilde. Er besass nur geringe Autorität, da die
wichtigeren Staaten wie Österreich, Preussen und Bayern ihn an kurzer
Leine hielten. Aber er war ein eigenes Völkerrechtssubjekt und besass
einige supranationale Kompetenzen, nicht unähnlich der Europäischen
Union - freilich wird auf diesen Vorläufer heute kaum je Bezug genommen,
wahrscheinlich weil er nur gerade ein halbes Jahrhundert überdauert
hat.
Die massgeblichen Akteure auf dem
Kongress waren sich bewusst, dass man nach zwanzig Jahren Krieg und
Revolution nicht unbesehen die alten Verhältnisse wiederherstellen
konnte. Die Beziehungen unter den Staaten sollten mehr auf rechtlichen
Grundsätzen beruhen. So verbot der Kongress auf Betreiben von
Grossbritannien den Sklavenhandel generell. Oder er regelte erstmals die
Schifffahrt auf den Flüssen. Er schuf die Zentralkommission für die
Rheinschifffahrt und damit die erste internationale oder regionale
Organisation. Auch stellte er das ewige Gezänk unter Diplomaten um Rang
und Vorrang ab, indem er ein einfaches Reglement erliess, das den
protokollarischen Umgang bis heute bestimmt. Es besagt: Der Vorrang
kommt jenem Diplomaten zu, der innerhalb seiner Kategorie, zum Beispiel
Botschafter oder Geschäftsträger, länger am Dienstort ist. Die Grösse
und die Bedeutung einer Nation, auf die sich die Streithähne bisher
immer wieder berufen hatten, spielten keine Rolle mehr. Insgesamt
schneidet der Wiener Kongresses in puncto Effizienz im Vergleich zum
heutigen multilateralen Konferenzbetrieb recht vorteilhaft ab.
Das «Ungeheuer Gleichgewicht»
Vor allem erkannten die
wichtigeren Kongressteilnehmer, dass die im 18. Jahrhundert
vielgepriesene Doktrin des Gleichgewichts gescheitert war. Das
«Ungeheuer Gleichgewicht», wie der pfiffige Toggenburger Ulrich Bräker
spottete, diente ja meistens ohnehin nur dazu, die ruchlose Machtpolitik
rivalisierender Herrscherhäuser zu kaschieren. Wenn es dessen noch
bedurft hätte, so bewies gerade die Schreckensnachricht von der Rückkehr
Napoleons, dass die Grossmächte nicht mehr gegeneinander, sondern
miteinander handeln mussten. In Wien kam die Idee von einer kollektiven
Sicherheit auf. Mit dem Zweiten Pariser Frieden wurde sie konkretisiert.
Castlereagh drängte darauf, dass die Monarchen der Quadrupelallianz
oder deren Gesandte periodisch zusammenkamen, um gemeinsame Probleme zu
beraten. Und Zar Alexander träumte von einer «Heiligen Allianz», die
alle christlichen Staaten zur Verteidigung einer auf christlichen
Grundsätzen errichteten Ordnung vereinen sollte.
Tatsächlich kam die Allianz
zustande. Ausser Grossbritannien und dem Kirchenstaat traten ihr alle
christlichen Staaten Europas bei. Aber Metternich hatte die
Stossrichtung der Vereinigung geändert. Nicht mehr die Verteidigung von
christlichen Werten sollte sie bezwecken, sondern die bestehende Ordnung
vor bürgerlichen und nationalstaatlichen Umwälzungen schützen. Die
Quadrupelallianz beziehungsweise, nach Frankreichs Beitritt, die
Pentarchie sah sich als operativer Arm der Heiligen Allianz. Sie
beanspruchte für sich ein Interventionsrecht. Die Kleinen, ohnehin in
die Kulissen abgedrängt, waren bereit, die Autorität der Grossen zu
respektieren, solange diese ihre Unabhängigkeit gewährleisteten. Man
schickte sich ins Biedermeier.
Das Kongress-System vermochte die
internationale Sicherheit nicht langfristig zu garantieren. Nachdem sich
die napoleonische Gefahr endgültig verzogen hatte, schwand der Fundus
an Gemeinsamkeiten. Die Heilige Allianz zerbrach schon bald an
Meinungsverschiedenheiten über den Freiheitskampf der Griechen. Doch das
Konzert der Mächte brachte eine wesentliche Neuerung in der
Arbeitsweise der Diplomatie. Der angestrebte Wechsel von Machtrivalität
hin zu vermehrter zwischenstaatlicher Zusammenarbeit erforderte eine
quasi permanente multilaterale Diplomatie. Die Grossmächte etablierten
diese mit einer Folge von Fürstenkongressen. Vorher hatte es nichts
dergleichen gegeben. Nicht zufällig studierte das britische Foreign
Office nach dem Ersten Weltkrieg den Wiener Kongress. Ein Historiker
hatte Elemente zu identifizieren, die man zum Aufbau des Völkerbunds
übernehmen konnte.
Die Spuren des Kongresses sind
über den Völkerbund bis zu den Vereinten Nationen im Institutionellen
deutlich ablesbar. Alle drei kollektiven Sicherheitsorganisationen
strebten bzw. streben eine möglichst breit abgestützte Mitgliedschaft
von Staaten an, sahen bzw. sehen ein Führungsorgan für die wichtigsten
Entscheide vor (Fünferausschuss, Völkerbundrat, Uno-Sicherheitsrat),
hielten bzw. halten periodische Versammlungen ab (Kongresse und
Botschafterkonferenzen, Völkerbundversammlung, Uno-Vollversammlung), und
zwischen den Tagungen betreute bzw. betreut ein Sekretariat die
Geschäfte. Jede der drei Organisationen verlor auch, so muss man wohl
anfügen, rasch ihren Elan. Von der Anlage her sind Konferenzen besser
geeignet, Meinungsdifferenzen auszutragen, als sich zu gemeinsamen
Aktionen aufzuraffen.
Wie jede Grosskonferenz erledigte
auch der Wiener Kongress vieles von dem nicht, was er sich vorgenommen
hatte. Kein Wort zu den Verhältnissen auf dem Apennin, kein Wort zur
Neuordnung auf dem Balkan. Die Zeit dazu reichte nicht. Das sollte sich
rächen. In der zweiten Hälfte des Jahrhunderts schlitterte der Balkan
von einer Krise in die andere. Dieser Brandherd löste schliesslich den
Ersten Weltkrieg aus. Die Ursache freilich lag anderswo. Die in der
Heiligen Allianz beschworene Solidarität unter den Fürstenhäusern war
zusehends abgebröckelt und nach dem Krimkrieg (1853-1856) reiner
Machtrivalität gewichen.
Stabilität und Intervention
Anderes wollte der Kongress gar
nicht erledigen. Für die bürgerlichen und nationalstaatlichen
Forderungen hatte er kein Gehör. Vielmehr war es sein Ziel, solche
Bewegungen in Schach zu halten. Er erkannte die Zeichen der Zeit nicht
und verpasste folglich, die staatliche Neuordnung Europas mit
Anpassungen an den gesellschaftlichen Wandel zu verbinden. Das sollte
sich mit zahlreichen Aufständen und namentlich den Revolutionen von 1830
und 1848 rächen. Das Verdienst des Wiener Kongresses besteht darin,
nach mehr als zwanzig Jahren Krieg und Zerstörung eine lang dauernde
Friedensordnung geschaffen zu haben. Diese funktionierte fünfzig Jahre
lang gut und nachher nochmals fünfzig Jahre lang schlecht und recht, ehe
sie im Ersten Weltkrieg unterging.
Die Stabilität wurde freilich durch
ein massives Interventionsrecht für die Grossmächte erkauft. Das
missfiel schon damals allen ausser den Monarchisten. Die Bilanz ist
somit durchaus zwiespältig. Den Zwiespalt zwischen Stabilität und
Intervention, zwischen Durchsetzung von Prinzipien und der Respektierung
souveräner Staatlichkeit, haben wir bis heute nicht befriedigend
gelöst.
Paul Widmer, alt
Botschafter, ist Lehrbeauftragter für internationale Beziehungen an der
Universität St. Gallen. Neueste Buchveröffentlichung: «Minister Hans
Frölicher. Der umstrittenste Schweizer Diplomat» (NZZ-Libro, Zürich
2012)