US-Frauen als Sklavenhalter
Zum Sex gezwungen, um als Amme zu dienen
Im Sommer 1619 wurden 20 afrikanische Sklaven nach Jamestown in der
Kolonie Virginia gebracht. Damit kam die Sklaverei nach Nordamerika.
Frauen waren daran aktiver beteiligt als lange angenommen.
Am 20. August 1619 verloren die USA ihre Unschuld, obwohl sie noch gar nicht gegründet waren. An diesem Tag ging ein niederländisches Schiff im Hafen von Jamestown, der ersten dauerhaften englischen Siedlung in Nordamerika, vor Anker. Die Ladung weckte das Interesse der Bewohner, handelte es sich doch um Sklaven aus Afrika. 20 von ihnen fanden bald einen Käufer, die sie als Arbeitskräfte auf den Tabakplantagen einsetzten, mit der die künftige Kronkolonie Virginia zu Wohlstand kommen sollte.
Das Beispiel machte Schule. Je mehr Siedler nach Nordamerika kamen und weitere Kolonien gründeten, desto mehr Sklaven aus Afrika wurden importiert. Bis zum Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges gegen die englische Krone 1775 waren es mehr als 300.000. Auch nachdem die 13 Kolonien ihre Unabhängigkeit erkämpft und sich die freiheitlichste Verfassung des Planeten gegeben hatten, blieb fast ein Fünftel ihrer Bewohner Sklaven - belebte Dinge, Produktionswerkzeuge, Handelsware.
Bereits im Vorfeld des 400. Jahrestages des Geschäfts von Jamestown drängt die Sklaverei in den USA ins Tagesgespräch. Nicht nur, dass die rassistischen Anschläge in US-Südstaaten in jüngster Zeit dieses dunkle Kapitel der amerikanischen Geschichte wieder ins öffentliche Bewusstsein gehoben haben. Vor allem bringen – wie das anlässlich markanter Gedenktage so ist – Ausstellungen, Studien, Bücher bislang unbekannte Aspekte des Themas ans Licht.
Das gelingt auch Stephanie Jones-Rogers mit ihrem Buch „They Were Her Property“ (Sie waren ihr Eigentum). Darin entzaubert die Historikerin von der Universität von Kalifornien in Berkeley einen Mythos der Sklavereigeschichte. Frauen in den US-Südstaaten, so die überkommene Meinung, hätten bei der Haltung der Sklaven keine große Rolle gespielt. Doch das Gegenteil war der Fall. Sie waren höchst aktiv an der Unterdrückung der Menschen beteiligt, die vor dem Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkriegs 1861 ein Drittel der Einwohnerschaft in den sklavenhaltenden Staaten ausmachten.
Am 20. August 1619 verloren die USA ihre Unschuld, obwohl sie noch gar nicht gegründet waren. An diesem Tag ging ein niederländisches Schiff im Hafen von Jamestown, der ersten dauerhaften englischen Siedlung in Nordamerika, vor Anker. Die Ladung weckte das Interesse der Bewohner, handelte es sich doch um Sklaven aus Afrika. 20 von ihnen fanden bald einen Käufer, die sie als Arbeitskräfte auf den Tabakplantagen einsetzten, mit der die künftige Kronkolonie Virginia zu Wohlstand kommen sollte.
Das Beispiel machte Schule. Je mehr Siedler nach Nordamerika kamen und weitere Kolonien gründeten, desto mehr Sklaven aus Afrika wurden importiert. Bis zum Ausbruch des Unabhängigkeitskrieges gegen die englische Krone 1775 waren es mehr als 300.000. Auch nachdem die 13 Kolonien ihre Unabhängigkeit erkämpft und sich die freiheitlichste Verfassung des Planeten gegeben hatten, blieb fast ein Fünftel ihrer Bewohner Sklaven - belebte Dinge, Produktionswerkzeuge, Handelsware.
Bereits im Vorfeld des 400. Jahrestages des Geschäfts von Jamestown drängt die Sklaverei in den USA ins Tagesgespräch. Nicht nur, dass die rassistischen Anschläge in US-Südstaaten in jüngster Zeit dieses dunkle Kapitel der amerikanischen Geschichte wieder ins öffentliche Bewusstsein gehoben haben. Vor allem bringen – wie das anlässlich markanter Gedenktage so ist – Ausstellungen, Studien, Bücher bislang unbekannte Aspekte des Themas ans Licht.
Das gelingt auch Stephanie Jones-Rogers mit ihrem Buch „They Were Her Property“ (Sie waren ihr Eigentum). Darin entzaubert die Historikerin von der Universität von Kalifornien in Berkeley einen Mythos der Sklavereigeschichte. Frauen in den US-Südstaaten, so die überkommene Meinung, hätten bei der Haltung der Sklaven keine große Rolle gespielt. Doch das Gegenteil war der Fall. Sie waren höchst aktiv an der Unterdrückung der Menschen beteiligt, die vor dem Ausbruch des Amerikanischen Bürgerkriegs 1861 ein Drittel der Einwohnerschaft in den sklavenhaltenden Staaten ausmachten.
Zum Beispiel Martha Gibbs. Sie besaß in Vicksburg im US-Bundesstaat Mississippi ein Sägewerk, das von zahlreichen Sklaven betrieben wurde. Martha Gibbs sorgte insofern gut für ihre Sklaven, als sie zwei Häuser für ihre Unterbringung hatte bauen lassen und sogar eine Kirche. Dass sie ihnen auch ausreichend Nahrung zur Verfügung stellte, war hingegen üblich, denn Sklaven waren ein wertvolles Eigentum, dessen Arbeitskraft es zu erhalten galt. Schließlich war die Einfuhr von Sklaven seit Anfang des 19. Jahrhunderts verboten. Zwischen 1800 und 1860 stieg der Preis für einen gesunden Afroamerikaner von 600 auf 1600 bis 1800 Dollar.

Ihr persönliches Eigentum: Sklaven unter Aufsicht bei der Baumwollernte
Wie andere Sklavenbesitzer auch ließ Martha Gibbs ihre Leute von schwer bewaffneten Aufsehern bewachen. Schließlich war ein möglicher Aufstand das Trauma des Südens. Als ihr Ehemann gegen das brutale Auspeitschen von Sklaven protestierte, wies sie ihn streng darauf hin, dass die Sklaven ihr persönliches Eigentum seien.
In den Nordstaaten ging die Sklavenhaltung nach der Gründung der USA schnell zurück. Sie entpuppte sich dort als wirtschaftlich unrentabel und galt zudem als moralisch fragwürdig. Im Süden wurde dagegen die Sklaverei nach der Erfindung der Baumwoll-Entkörnungsmaschine (Cotton Gin) durch Eli Whitney 1793 zur Grundlage unvorstellbaren Reichtums. Da Baumwolle nun arbeitsökonomisch in großem Stil verarbeitet werden konnte, stiegen die US-Südstaaten zum weltgrößten Exporteur dieses Schlüsselprodukts der Industrialisierung auf.

Diese Erfindung zementierte die Sklaverei in den USA
Zwischen 1812 und 1860 steigerten die Pflanzer zwischen North Carolina und Louisiana die Jahresproduktion des Weißen Goldes von weniger als 300.000 auf mehr als vier Millionen Ballen. Das waren gut zwei Drittel der Weltproduktion. Die Sklaven haltende Pflanzeraristokratie avancierte zur wohlhabendsten Unternehmergruppe der Erde.
Zu ihnen gehörten Ehefrauen, Witwen, Erbinnen, Nonnen. Die Ursulinen in New Orleans etwa engagierten sich aktiv im Handel mit Sklaven und ließen sie auf ihren Plantagen arbeiten. Paradoxerweise ermöglichte der Besitz von Sklaven Frauen die eigene Freiheit auf Kosten anderer. Der Handel mit Sklaven war nicht an einen Ort gebunden, er konnte überall stattfinden, so auch im informellen Kontext eines Wohnzimmers oder auf der Veranda eines Privathauses.
![Cotton is king - plantation scene with pickers at work. Georgia', c1900. [Underwood & Underwood, New York, London, Toronto-Canada, Ottawa-Kansas, 1900]. (Colorised black and white print). Artist Unknown.. (Photo by The Print Collector/Getty Images) Getty ImagesGetty Images](https://www.welt.de/img/geschichte/mobile191039527/2192506947-ci102l-w1024/Cotton-Is-King-Plantation-Scene-With-Pickers-At-Work-Georgia-C1900.jpg)
um 1900 in Georgia
Stephanie Jones-Rogers weist nach, dass Frauen in den Südstaaten gerne von den Eltern zu wichtigen Ereignissen in ihrem Leben Sklaven geschenkt bekamen – und zwar mit Brief und Siegel, so blieben die Eigentumsverhältnisse auch bei einer Heirat unangetastet. Tatsächlich zögerten Frauen nicht, örtliche oder staatliche Gerichte in Anspruch zu nehmen, wenn ihre Ehemänner sich an ihrem „Besitz“ vergriffen.
Dies war beispielsweise der Fall, wenn Sklaven brutal ausgepeitscht wurden. Das minderte ihre Arbeitskraft und schädigte damit das persönliche Einkommen der Gattin. Ein anderer häufiger Fehltritt war sexueller Natur. Viele weiße Männer nutzten ihre Überlegenheit zur schnellen Triebbefriedigung, was ihre Ehefrauen kaum goutierten, zumal wenn Kinder mit brauner Hautfarbe auf die Welt kamen.
Besonders beliebt waren weibliche Sklaven als Geschenk, denn sie waren eine Investition in die Zukunft; schließlich konnten sie Kinder zur Welt bringen, die dann ebenfalls der Eigentümerin gehörten. Da der internationale Menschenhandel verboten war, kam dem nationalen Geschäft mit Sklaven sowie ihrer Reproduktion größte Bedeutung zu. Nicht von ungefähr stieg die Zahl der Sklaven in den Südstaaten auf vier Millionen im Jahr 1860.
Sklavinnen erfüllten noch einen weiteren Zweck: Sie konnten ihrer „Eigentümerin“ als Amme dienen. Stephanie Jones-Rogers hat entsetzliche Fälle von sexueller und psychischer Gewalt recherchiert. Emily Haidee, eine Sklavenhalterin aus Louisiana, zwang ihre Sklavin Henrietta Butler zu Sex mit einem Mann auf der Plantage. Die Sklavin wurde schwanger, das Kind starb kurz nach der Geburt. Während Henrietta Butler noch um ihr Kind trauerte, musste sie das Baby ihrer „Herrin“ stillen.
Am 1. Januar 1863 trat die „Emanzipationsproklamation“ von US-Präsident Abraham Lincoln in Kraft, nach der alle Menschen, die als Sklaven in den Südstaaten gehalten werden, „fortan und für immer frei sein sollen“. Überall da, wo Unionstruppen auf dem Vormarsch waren, wurde die Proklamation in die Tat umgesetzt, was dem Süden seiner mobilen Vermögenswerte beraubte. Für die endgültige Abschaffung sorgte der 13. Zusatzartikel zur Verfassung vom 18. Dezember 1865.
Um den Widerstand der Sklaven haltenden Staaten Missouri, Kentucky, Maryland und Delaware, die zur Union gehalten hatten, gegen eine Aufhebung der Sklaverei zu brechen, hatte Lincoln anfangs eine Entschädigung der Sklavenhalter ins Spiel gebracht. Stephanie Jones-Rogers weist nach: 40 Prozent der Eingaben erfolgten von Frauen. Unter ihnen befanden sich auch Mitglieder weiblicher Ordensgemeinschaften wie die Schwestern von der Heimsuchung Mariens (Visitantinnen) in Georgetown (Washington D.C.)
Stephanie E. Jones-Rogers: „They Were Her Property. White Women as Slave Owners in the Amerikan South“. (Yale University Press, 320 S., ca. 28,50 Euro)
Nota. - Das Wort Negersklaven kommt gar nicht vor. Das waren schon damals "Afroamerikaner". So fälscht der gute Wille die Geschichte und merkt es nicht.
JE






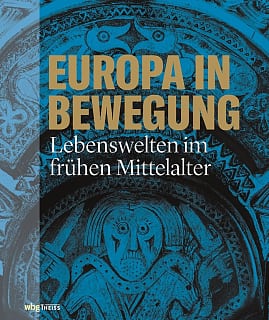



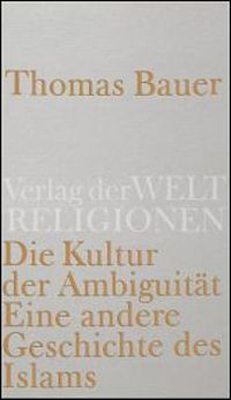 cover: verlag der weltreligionen
cover: verlag der weltreligionen
