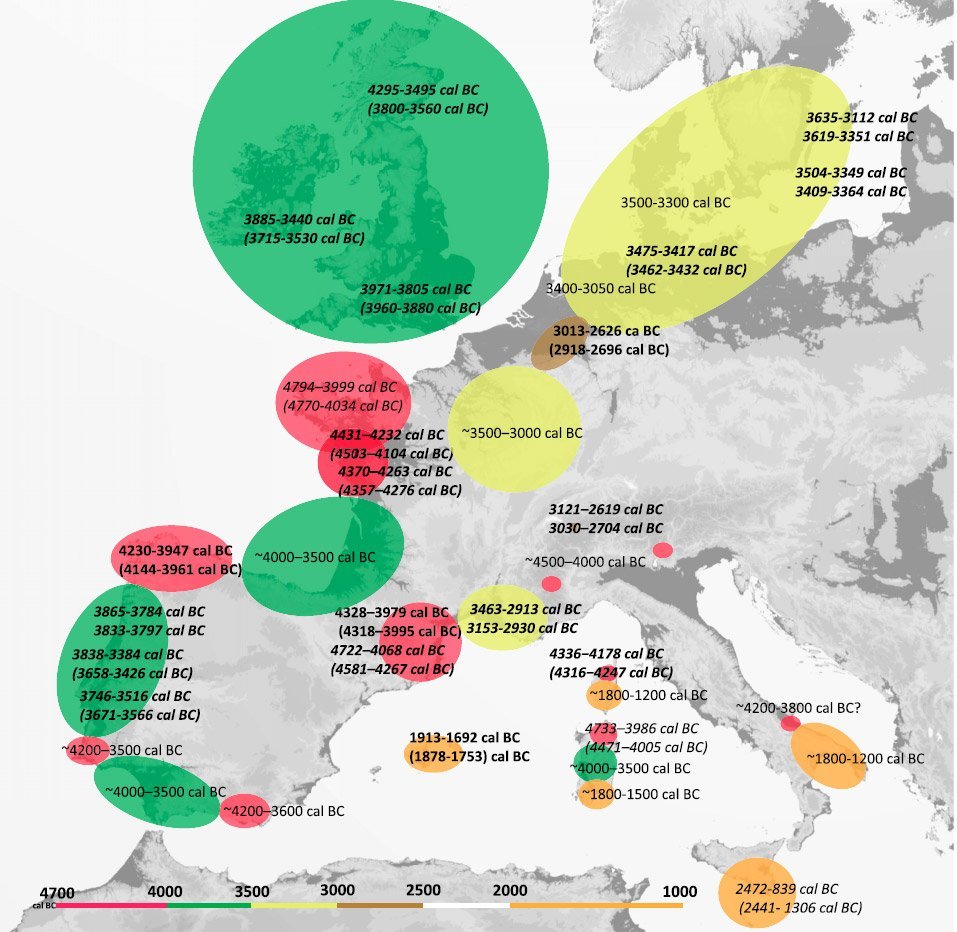aus nzz.ch, 26.2.2019
Wie die Einwanderer Europa eroberten
«So
etwas hatte Europa noch nicht erlebt», hebt diese Saga an. «Der Strom
an Migranten, der über den Balkan ins Zentrum des Kontinents vordrang,
markierte eine echte – hier passt das Wort tatsächlich – Zeitenwende.»
Die
Grossfamilien, die entlang der Donau kamen, nahmen das neue Land in
ihren Besitz. Die eingeborenen Europäer zogen sich zurück und gaben
schliesslich auf. Das hiess: «Die Menschen, die Europa fortan bewohnten,
sahen anders aus als jene, die sie verdrängt hatten – ein
Bevölkerungsaustausch.»
Was
der Genetiker Johannes Krause und der Journalist Thomas Trappe, der
sich gerne mit den Rechtspopulisten anlegt, im Prolog ihres Buches
raunen, fand vor 8000 Jahren statt. Aber die Autoren spielen lustvoll
mit der Zweideutigkeit: Den Anstoss zu ihrem Buch über die frühesten
Einwanderer in Europa gab die Flüchtlingskrise im Sommer 2015, als
wieder ein Strom von Migranten nach Deutschland zog. Sie wollen zu den
Debatten, die vor vier Jahren ausbrachen, einen Beitrag leisten. Denn
mit dem genetischen Erbe der Menschen lässt sich seit je Politik machen.
Das Wissen der Gene
Vom
Blut, also von Völkern, Rassen oder auch Nationalcharakteren zu
sprechen, traut sich nach den Greueln der Nazis zwar kaum mehr jemand.
Was diese dachten, treibt aber immer noch viele Politiker um, ob nun
indische Eliten gegen die Erkenntnis kämpfen, dass ihre Hochkultur mit
Eindringlingen kam; ob italienische Politiker einhellig an Unterschiede
im Erbgut glauben, die den Norden vom Süden des Landes trennen; ob der
ungarische Ministerpräsident nach der richtigen Abstammung seiner
Landsleute fragt oder sich eine amerikanische Präsidentschaftskandidatin
als Nachfahrin der Ureinwohner wähnt.
Ja,
die Gene wiegen schwerer denn je, weil sie sich heute schnell und
günstig lesen lassen. Nur zwanzig Jahre nach der milliardenteuren
Entschlüsselung des menschlichen Genoms kennen schon Millionen dank
Tests von Firmen wie Insitome oder 23andMe ihr Erbgut. Und die
Archäogenetiker spüren mit kleinsten Fragmenten von Zehntausende Jahre
alten Skeletten der Entwicklung von Homo sapiens nach. «Es wäre geradezu
vergeudete Forschermühe», meinen deshalb Johannes Krause und Thomas
Trappe, «dieses Wissen im Knochenstaub ruhen zu lassen.»
Mit ihren Erkenntnissen rücken die Archäogenetiker unser Bild vom Menschen zurecht, auch die Wege, wie er die Welt eroberte.
Der
Schwede Svante Pääbo, Direktor des Max-Planck-Instituts für
evolutionäre Anthropologie in Leipzig, wies als Pionier des Fachs nach,
dass sich die modernen Menschen nach ihrem Auszug aus Afrika vor 50 000
Jahren mit Neandertalern paarten, weshalb wir auch deren Gene
weitergeben. Sein Meisterschüler Johannes Krause fand dank einer 70 000
Jahre alten Fingerkuppe aus einer Höhle im sibirischen Altai-Gebirge mit
den Denisovanern eine bis dahin unbekannte Menschenart. Und sein
Forschungspartner David Reich baute an der Harvard Medical School eine
«Genfabrik» auf, wo er mit Tausenden von Proben die brisanten Fragen der
Besiedlung von Indien, Europa oder Amerika zu klären versucht.
Ihre
Studien in den renommiertesten Journalen stiessen auf so grosses
Interesse, dass sich die Archäogenetiker mit Büchern auch an ein breites
Publikum wenden. Svante Pääbo machte 2014 den Anfang mit «Die
Neandertaler und wir: Meine Suche nach den Urzeit-Genen». David Reich
löste im Frühling 2018 mit «Who We Are and How We Got Here» eine Debatte
aus, die die «New York Times»
noch im Januar 2019 mit einer giftigen Attacke weiterdrehte, weil er
bei seiner Arbeit auch darüber nachdachte, wie wir den Begriff der Rasse
richtig brauchen. Und Johannes Krause legt jetzt «Die Reise unserer
Gene» vor, ein eingängig geschriebenes Buch, «das nicht nur politische
Kontroversen adressiert, sondern auch erstmals die Erkenntnisse der
Archäogenetik über die Geschichte Europas in einem deutschsprachigen
Werk zusammenfasst».
Debatten im Hinterkopf
Diese
Affiche ist allerdings nicht ganz richtig. Die schwedische Journalistin
Karin Bojs gab schon 2015 ein brillantes Buch heraus, in dem sie mit
Reportagen – von Svante Pääbos Labor in Leipzig über die Höhlenmalereien
in der Dordogne bis hin zur Heimat ihrer Vorfahren – die Suche nach
ihren eigenen Wurzeln mit einer Übersicht über die neuste Wissenschaft
verknüpft. In Schweden ein Bestseller, kam das Werk in mehreren
Übersetzungen heraus, so letztes Jahr auch auf Deutsch: «Meine
europäische Familie. Die ersten 54 000 Jahre».
Wie
Johannes Krause und Thomas Trappe schreibt Karin Bojs mit den
politischen Debatten im Hinterkopf. So steht sie im Museum in Stockholm
vor der Nachbildung einer Frau, die vor 9000 Jahren lebte, aber mit
heller Haut und hellen Haaren aussieht wie eine Landsfrau von heute.
«Ich habe blaue Augen, sehr blonde Haare und eine sehr bleiche Haut, wie
das Stereotyp einer Schwedin», denkt die Journalistin. «Aber die
Wahrheit ist, dass im heutigen Schweden weitaus nicht alle aussehen wie
ich.» Auch die Jäger und Sammler der Jungsteinzeit nicht: Die Genetiker
wissen jetzt, dass diese Ureinwohner Europas zwar blaue Augen hatten –
doch eine dunkle Haut.
Heute
zeugen die Gene der Europäer von drei Einwanderungswellen. Erstens
zogen vor 50 000 Jahren moderne Menschen wohl aus Palästina nach Europa
und hielten als Jäger auch in der Eiszeit durch, anders als die
Neandertaler.
Zweitens
kamen vor 8000 Jahren die ersten Bauern aus Anatolien – während die
Archäologen bisher annahmen, dass sich die Landwirtschaft unter den
Eingeborenen verbreitete, weisen die Genetiker jetzt nach, dass sie
Einwanderer mit ganz anderem Erbgut mitbrachten.
Und
drittens drangen vor 4800 Jahren, bei der grössten Migrationswelle
aller Zeiten, Hirten mit Pferden und Wagen aus der russischen Steppe
ein: Es gab also tatsächlich ein Volk, das Nordindien und Westeuropa
seine Gene, seine Kultur und seine Sprache aufzwang – und es kam aus dem
Osten.
Die Gene
dieser drei Gruppen machen jetzt, in regional unterschiedlicher
Mischung, das Erbe der Europäer aus. Spätere Migrationen führten nicht
mehr zu einem genetischen Austausch, der sich messen lässt, nicht einmal
die Völkerwanderung vom 4. bis zum 6. Jahrhundert.
Wir sind alle Migranten
Welche
Menschen für eine Region typisch, weil seit je einheimisch sind, lässt
sich aufgrund der Genetik kaum mehr sagen. David Reich stellt fest: «Die
Menschen, die heute an einem Ort leben, stammen fast nirgends
ausschliesslich von den Menschen ab, die in der fernen Vergangenheit an
diesem Ort lebten.» Und Johannes Krause und Thomas Trappe wissen: «Die
Archäogenetik zeigt, dass es Menschen mit ‹reinen› europäischen Wurzeln
nicht gibt und wohl auch nie gab. Wir alle haben einen
Migrationshintergrund.»
Europa,
meinen die Autoren gar, lasse sich verstehen als «eine sich über
Jahrtausende erstreckende Fortschrittsgeschichte, die ohne die Migration
und Mobilität von Menschen unmöglich gewesen wäre». Das heisst
allerdings nicht, dass sie die Einwanderung gemäss ihren politischen
Neigungen unkritisch feiern: «Das Buch liefert, dessen sind wir uns
bewusst, Argumente für diejenigen, die gegenüber der Migration
aufgeschlossen sind, wie auch für jene, die ihr strikte Grenzen setzen
wollen.»
Die
Genetiker zeigen durchaus, dass es Eigenheiten im Erbgut von
Bevölkerungsgruppen gibt. So leben die Tibeter in sauerstoffarmer Luft
mit einem Gen, das von den Denisovanern stammt. Und so nützt den
Westafrikanern ein Gen, das zu «schnellen» Muskeln führt: David Reich
wies darauf hin, dass alle Finalisten des 100-Meter-Laufs an den
Olympischen Spielen seit 1980 Wurzeln in Westafrika hatten – und erntete
allein für diese Feststellung Prügel.
Vor
allem lehren die Evolutionsbiologen, dass sich Bevölkerungsgruppen
nicht nur mit ihren Genen, sondern auch mit ihrer Kultur der
heimatlichen Umwelt anpassen und sich gegen Fremde verteidigen. Starke
Einwanderung löst deshalb Konflikte aus, damals und heute, wie Johannes
Krause und Thomas Trappe einräumen. Eine Klimaerwärmung könne durchaus
zu einem Plus an bebaubaren Flächen führen, meinen sie: «Allerdings ist
nicht absehbar, welche politischen Verwerfungen und Konflikte daraus
resultierende Migrationen hervorrufen würden. Oder besser gesagt, man
will es sich lieber nicht vorstellen.»
Johannes
Krause, Thomas Trappe: Die Reise unserer Gene. Eine Geschichte über uns
und unsere Vorfahren. Propyläen, Berlin 2019. 288 S., Fr. 25.90.
Karin Bojs: Meine europäische Familie. Die ersten 54 000 Jahre. WBG Theiss, Stuttgart 2018. 431 S., Fr. 41.90.