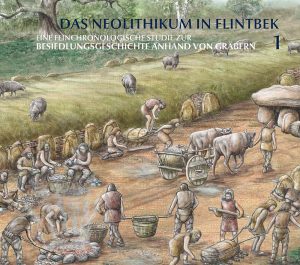wikipedia
wikipedia
aus FAZ.NET, 27. 4. 2022
Von
Oliver Jungen
Man
darf ihn Epimenides nennen, den Elefanten, der hier im Raum ist, nach
jenem Kreter also, der sagte, dass alle Kreter lügen, und damit die
Selbstaussage ad absurdum führte. Wenn ein kanadischer Anthropologe und
Evolutionspsychologe, der in Harvard
lehrt, darauf hinweist, dass „sonderbare Menschen“ – grob gesprochen:
Bewohner des christlich geprägten Westens („WEIRD“ ist das Akronym dazu:
„Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic“) – dazu neigten,
die Welt durch eine sonderbare Brille zu sehen, dann stellt sich wohl
die Frage, ob dieser Westler, der den Westen auch gleich mit der
„modernen Welt“ überblendet, die Brille wirklich abgenommen hat. Und in
der Tat: So beachtlich viel Wissen Joseph Henrich in seiner
Universaltheorie auch kompiliert (allein das Literaturverzeichnis
umfasst neunzig Seiten), hinterlässt sein Buch den schalen Geschmack von
Abendlandsduselei.
Der Autor schreibt den
Westlern im Unterschied zur übrigen Welt etwa einen höheren Grad an
analytischem Denken, Individualismus, Vertrauenswürdigkeit, Fleiß,
Ehrlichkeit, Selbstbeherrschung, Geduld und „unpersönlicher
Prosozialität“ (gegenüber Fremden) zu, alles vermeintlich
wissenschaftlich bewiesen durch diverse vergleichende Sozialexperimente.
Es handele sich, das ist Henrichs zentrale Botschaft, um kulturell
erworbene Charaktereigenschaften; genetisch wirke sich das allenfalls in
Jahrtausenden aus. Diese elefantöse Studie ist die vielleicht
seltsamste Version des kulturalistischen Eurozentrismus (der Nordamerika
inkludiert).
Eher eine gefühlte Zahl
Sonderbar ist der Autor auch in einer
speziellen Hinsicht. Seit der Frühen Neuzeit, heißt es einmal, herrsche
im Westen die sonderbare Auffassung, „dass jeder einzelne Mensch
vollkommen neues Wissen entdecken konnte“. Henrich gibt sich zwar Mühe,
besagten Genieglauben zu widerlegen – komplexe Innovationen entstünden
aus der „Addition kleiner Erweiterungen“ –, aber dass er selbst etwas
vollkommen Neues entdeckt hat, einen „massiven psychologischen und
neurologischen Eisberg, den viele Forscher einfach übersehen haben“,
dieser unbescheidene Anspruch springt die Leser seines Buchs geradezu
an.
Experimentell
arbeitenden Disziplinen wie der Sozialpsychologie, der
Kulturanthropologie oder auch den Wirtschaftswissenschaften macht der
Autor dabei den massiven Vorwurf, meist nur die eigenen Studenten
erforscht zu haben: „Selbst heute . . . sind immer noch über neunzig
Prozent der Teilnehmerinnen an experimentellen Studien sonderbar.“ Es
ist wohl eher eine gefühlte Zahl. Henrich muss dermaßen laut trommeln,
um zu verdecken, dass seine auf über neunhundert Seiten ausgebreiteten
Befunde aus der angewandten Völkerpsychologie keineswegs sonderlich neu
sind. Wobei er, trotz seiner Hinweise auf eine starke Varianz innerhalb
der europäischen/amerikanischen und der außereuropäischen Kohorte sogar
einen grundsätzlichen Dualismus feststellen zu können glaubt: „wir“ und
die Anderen
Altbekannt
seit Herbert Spencer ist auch die Rolle, die hier dem Sozialdarwinismus
zukommt, der bei Henrich „kulturelle Evolution“ heißt, aber ebenfalls
die Durchsetzung der fittesten gesellschaftlichen Gruppe meint. Was aber
erklärt nun den erfolgreichen europäischen Sonderweg?
Erstaunlicherweise hat der Autor dafür eine einzige und bis zum
Überdruss wiederholte Begründung parat. Denn obgleich er einmal
zustimmend Jared Diamonds Vermutung einer geographischen Begünstigung
Europas zitiert, führt Henrich beinahe alles zurück auf den Siegeszug
des Christentums.
Aufklärung und Industrialisierung als Folgen der veränderten Psychologie
Der Clou besteht darin, den entscheidenden
Hebel in der christlichen Sexualmoral zu sehen. Diese habe qua
Monogamiegebot und Inzesttabu die Vorstellung der Ehe revolutioniert.
Das Verbot der verbreiteten Vetternehe habe dem alten, tribalistischen
Gesellschaftsmodell und seinen etablierten Eliten – einer vor
Testosteron strotzenden Clanstruktur, wie sie außerhalb des
römisch-christlichen Einflussbereichs bestehen geblieben sei – den
Garaus gemacht und damit den Weg in eine von Städten, unpersönlichen
Märkten, Innovation und politischem Wettbewerb geprägte Moderne geebnet.
In einer solch
stammesfernen, „gezähmten“ Welt habe sich der Individualismus als
geeignetste psychologische Disposition erwiesen. Die nicht mehr in
verwandtschaftlichen Strukturen organisierte Bevölkerung wiederum habe
sich zu neuen, freiwilligen Bündnissen zusammengeschlossen, woraus
Institutionen wie Klöster, Gilden, Universitäten oder Städte entstanden
seien. Die wiederum verstärkten die „sonderbare“, kooperative Denkweise
der Menschen. Die wichtigste Neuprogrammierung des Westler-Gehirns fand
demnach im Mittelalter statt; Aufklärung und Industrialisierung seien
nur die logische Folge der veränderten Psychologie gewesen.
Der Autor hat sich verrannt in seine Weltformel
Das alles wird über zahlreiche Stufen und
Exkurse – etwa zur Geschichte der Lohnarbeit – entwickelt und
abgeglichen mit Feldstudien zu Ethnien, die in verwandtschaftsbasierten
Strukturen leben. Manches Detail ist einsichtig (eine europäische
Kleinfamilie wirkt häufig „etwas egalitärer“ als eine arabische
Großfamilie), anderes widerspricht der Intuition. So war das europäische
Mittelalter doch regelrecht definiert durch eine patrilineare
Clanstruktur: die Hocharistokratie.
Das originelle
Zusammendenken verschiedenster Disziplinen ist anregend, das Buch trotz
seiner Überfülle gut lesbar und klar strukturiert. Doch gegen die
historische Argumentation gibt es so viel einzuwenden, dass von der
Generalthese jenseits unumstrittener Annahmen – Bedeutung der Kirche,
der Städte, des freien Handels, dazu eine Portion Max Weber
– wenig übrig bleibt. So hatte die Vetternehe auch in Europa noch
verschiedentlich Konjunktur. Und die übrige Welt pauschal als eine der
Stammesstrukturen aufzufassen übersieht alle Modernisierungsprozesse in
anderen Gesellschaften. Kriege führen im Westen angeblich zu effektiven
Institutionen wie Parlamenten, in der Clanwelt hingegen, vermutet der
Autor auf schmalster Quellenbasis, fördern sie „loyales Verhalten
gegenüber dem eigenen Clan oder der Verwandtschaft (Nepotismus), die
Vetternehe und den Respekt vor den Älteren“.
Aus der Zeit gefallen
Der Autor hat sich verrannt in seine
Weltformel, die er mit arbiträr wirkenden psychologischen Experimenten
und Statistiken zu unterfüttern sucht. Letztere vermögen das Gewicht der
ihnen unterstellten Aussage oft nicht zu tragen. Nur ein Beispiel:
„Regionen, die während des Mittelalters eine größere zisterziensische
Präsenz erfahren haben, sind im 21. Jahrhundert wirtschaftlich
produktiver und haben eine niedrigere Arbeitslosenquote.“ Für Henrich
ist damit belegt, dass die neue Arbeitsmoral (Fleiß, Pünktlichkeit)
nicht auf eine protestantische Ethik zurückgeht, sondern auf die
Zisterzienser einige Jahrhunderte zuvor. Der Protestantismus sei aber
doch ein „Booster“ der sonderbaren Entwicklung gewesen.
Heikler
noch als die freihändigen historischen Thesen ist die letztlich
kulturmorphologische Argumentation, nach der die nichtsonderbare Welt
ganzheitlich denke und auf jener (rückständigen) Stufe verharre, die im
westchristlichen Bereich durch das Wachstum des „europäischen
kollektiven Gehirns“ überwunden wurde. Dieses Gehirn stellt sich Henrich
als überlegen vor, „genialer“ und „erfindungsreicher“. Problematisch
sei daher der Export „höherer“ Institutionen wie Parlamente in
verwandtschaftsbasierte Gesellschaften, heißt es, denn sie passten nicht
„zur kulturellen Psychologie der Leute“. Die lasse sich nur über
Jahrhunderte trainieren.
Vollends
diskreditiert sich die aus der Zeit gefallene Studie dadurch, dass
Henrich die wahre Kollision des „Westens“ mit der übrigen Welt – und
damit die dunkle Gegenseite des individualistischen, nicht mehr lokal
gebundenen Gewinnstrebens –, also den Kolonialismus inklusive Rassismus
und Genoziden, komplett ausblendet. Dazu gebe es „viele Bücher“, heißt
es lapidar. Wie sein ebenfalls mit dubioser Methodik und viel
Euro-Optimismus arbeitender Harvard-Kollege Steven Pinker in „Gewalt.
Eine neue Geschichte der Menschheit“ (2011) stützt sich Henrich auf
Mordstatistiken, die einen Rückgang von Kapitalverbrechen seit dem hohen
Mittelalter zu zeigen scheinen, um ohne weitere Rücksichtnahme auf den
Umstand, dass von Europa die Unterwerfung ganzer Kontinente, der moderne
Sklavenhandel und zwei Weltkriege ausgingen, zu behaupten, in unserer
vom Konzept der „Familienehre“ bereinigten Wettbewerbsgesellschaft habe
sich „Selbstbeherrschung“ evolutionär durchgesetzt. Jähzorn kennen
demnach nur noch die (wilden) Anderen; Europäer sind seit Jahrhunderten
friedlich und zivilisiert. Sonderbar ist daran vor allem die
Autosuggestion. Manchmal sucht man ja seine Brille, bis einem auffällt,
dass sie die ganze Zeit auf der Nase sitzt.
Joseph Henrich: „Die seltsamsten Menschen der Welt“. Wie der Westen reichlich sonderbar und besonders reich wurde. Aus dem Englischen von Frank Lachmann und Jan-Erik Strasser. Suhrkamp Verlag, Berlin 2022. 918 S., Abb., geb., 34,– €.
Nota. - Auch wer aus gegebenem Anlass wiedermal den Untergang des Abendlands an die Wand malt, kann ja nicht übersehen, dass die Gegend, die wir heute den Westen nennen und die bis ins Mittelalter an der Peripherie der damals zivilisierten Welt lag, sich mit der Koloni-sierung Amerikas daran gemacht hat, fast die ganze Welt zu unterwerfen - und damit die Vorstellung von einer Welt überhaupt erst möglich gemacht hat. Die Triebkräfte dieses Auf-stiegs gälte es bloßzulegen, um zu beurteilen, ob und warum er dieser Tage zu Ende geht und was darauf folgen mag: Eine Theorie der Überlegenheit wird erforderlich.
Wer sie versucht, kann er darauf rechnen, dass alle Wohlmeinenden über ihn herfallen und die Herrenmenschen auch nicht zufrieden sind. Viel Rücksicht musste er also nicht nehmen: Ko-lonialismus und Genozide hat er ausgeblendet. Hätten sie der Analyse etwas wesentlich Neues hinzugefügt, oder soll lediglich Gerechtigkeit geschehen?
*
Ob ich das dicke Buch auf mich laden soll, kann ich noch nicht entscheiden, ich werde noch ein paar Rezensionen abwarten.
JE
 t-online
t-online