
aus Tagesspiegel.de, 15. 6. 2021 Ständiges
Ringen zwischen Bundesrat, Reichstag, Kaiser und Kanzler: Otto von
Bismarck, von 1871 bis 1890 erster Kanzler des Deutschen Reiches.
Von Dieter Langewiesche
Im Rückblick auf den 150. Jahrestag der Reichsgründung wird wieder über das Kaiserreich gestritten. Ein Historikerstreit ist daraus aber nicht hervorgegangen. Der Grund ist einfach: Es gibt kein neues Bild von diesem Nationalstaat, das mit den bisherigen Deutungen bricht. Ge-stritten wird über altvertraute Vorstellungen. Einhellig war das Bild nie, das man sich von die-sem Staat gemacht hat, auch nicht unter den Zeitgenossen. Doch die radikalen Umwertungen des Kaiserreichs geschahen erst nach dessen Ende. Erzwungen haben sie nicht neue For-schungsergebnisse.
Es waren vielmehr die Nachgeschichten, die das Kaiserreich in andere Entwicklungslinien einordneten. Das wohl berühmteste Beispiel bietet Thomas Mann. In seinen "Betrachtungen eines Unpolitischen", geschrieben im Ersten Weltkrieg, verteidigte er den "vielverschrieenen ,Obrigkeitsstaat'", 1945 verdammte er ihn, indem er ihn in eine Geschichtslinie rückte, die auf 1933 zulief: "Durch Kriege entstanden, konnte das unheilige Deutsche Reich preußischer Na-tion immer nur ein Kriegsreich sein. Als solches hat es, ein Pfahl im Fleische der Welt, gelebt, und als solches geht es zugrunde."Mit dem Wissen um die nationalsozialistische Gewaltherrschaft und den Genozid an den europäischen Juden entwarf Thomas Mann eine deutsche Geschichte, in der mit dem Kaiser-reich der Weg in die Katastrophen des 20. Jahrhunderts beginnt. Dieses Bild lebt mehr oder weniger modifiziert in jüngst erschienenen Büchern fort, die im Kaiserreich ein Geschichts-erbe sehen, das noch unsere Gegenwart belaste. Andere ziehen andere Geschichtslinien. In ihnen steht das Kaiserreich am Anfang von Aufbrüchen in eine bessere Zukunft. Sozialdemo-kratie und Gewerkschaften erstarkten, die Frauenbewegung ebenfalls, die Parlamente wurden einflussreicher, der Sozial- und der Kulturstaat wurden ausgebaut, die Lebensverhältnisse ver-besserten sich und die Lebenswartung stieg, um nur einiges zu nennen.
Kompetenzstreits wurden nicht nach rechtlichen Regeln, sondern anhand der jeweiligen Machtverhältnisse entschieden
Welche der beiden Geschichtsbilder, die es seit Langem gibt, ist angemessener? Auf For-schungsergebnisse berufen sich beide. Reinhart Kosellecks vielzitierte Formel von der "Veto-macht der Quellen" greift nicht, wenn es um lange Geschichtslinien geht. Sie werden durch die Perspektive bestimmt, mit der man die eigene Gegenwart in die Geschichte einordnet. Fach-wissenschaftlich lässt sich die Konkurrenz der Perspektiven nicht entscheiden. Deshalb ver-wundert es nicht, dass der gegenwärtige Streit um die Deutung des Kaiserreichs nichts Neues zu dessen Erforschung beiträgt und auch nicht auf neue Forschungsergebnisse reagiert. Hier prallen vielmehr vertraute Geschichtsbilder aufeinander, die das Kaiserreich gegensätzlich in der Geschichte verorten.
Oliver F. R. Haardt entzieht sich dieser Perspektivenkonkurrenz. Er untersucht das Regie-ungssystem des Kaiserreichs in dessen Lebenszeit, weder verdunkelt noch aufgehellt - je nach Standpunkt des Betrachters - durch die Nachgeschichten. Haardt erzählt die Geschichte eines ruhelosen Staates, voller Dynamik, nicht nur in Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur, das be-streitet ohnehin niemand, sondern auch politisch. Die Verfassung hat vieles offengelassen, sie besaß kein festes "Grundgerüst", das die Rivalität zwischen "monarchischen und parlamenta-rischen, unitarischen und partikularistischen, hegemonialen und bündischen Kräften" einge-hegt hätte.
Das machte sie flexibel und zugleich schwer berechenbar. Die Verfassungsinstitutionen rangen "andauernd um Entscheidungsbefugnisse", ein Ringen um Macht zwischen Bundesrat, Reichs-tag, Kaiser und Kanzler mitsamt den Reichsbehörden. Kompetenzstreitigkeiten ließen sich im-mer nur fallweise schlichten, entschieden wurden sie nicht nach rechtlichen Regeln, sondern anhand der jeweiligen Machtverhältnisse. Im Extremfall schien die gesamte Staatsordnung ge-fährdet, wenn der Kanzler mit dem Staatsstreich drohte, um die Gegenseite gefügig zu ma-chen. Hugo Preuß sprach deshalb 1887 vom "vollendeten Muster eines Staatsgrundgesetzes, wie es nicht sein sollte."
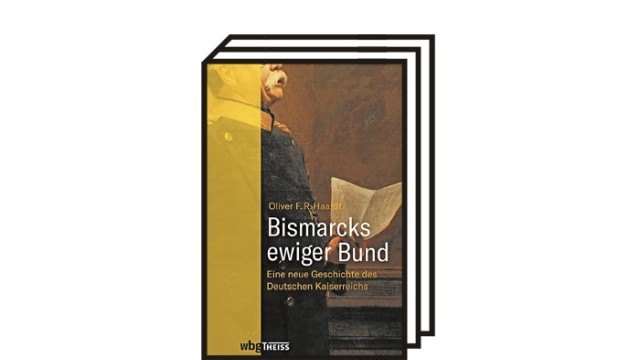
Oliver F. R. Haardt: Bismarcks ewiger Bund. Eine neue Geschichte des Deutschen Kaiserreichs. Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 2020. 944 Seiten, 40 Euro.
Haardt charakterisiert die Reichsverfassung als eine regelungsschwache Plattform für den institutionellen Machtwettbewerb. Die Grenzen staatlichen Handelns waren ebenso wenig präzise festgelegt wie die Beziehungen zwischen Reich und Einzelstaaten und zwischen den Bundesorganen. Bismarck hielt an der Illusion eines Fürstenbundes fest - die Verfassung spricht vom "ewigen Bund" -, doch schon in seiner Amtszeit entwickelte sich das Regie-rungssystem in Richtung Reichsmonarchie. Dies stärkte die unitarischen Organe, den Reichs-tag und den Kaiser, und ließ aus dem Kanzleramt eine Reichsregierung hervorgehen, die nicht vorgesehen war.
Der Bundesrat hingegen, zu dessen Hauptaufgaben es gehören sollte, eine Parlamentarisierung zu verhindern, verlor an Bedeutung und wurde in der Praxis zu einem Instrument der Reichs-regierung. Die eingehende Analyse dieser Entwicklung gehört zu den Glanzstücken des Bu-ches. Den widerspruchsvollen, wendungsreichen Weg, den das Zusammenspiel und Gegenein-ander der Verfassungsorgane zurücklegte, das konfliktbeladene Aushandeln zwischen föderaler und zentralstaatlicher Ordnung kennzeichnet Haardt als einen zweipoligen Prozess: die födera-len Entscheidungsprozesse wurden parlamentarisiert, die parlamentarischen föderalisiert.
Das mag abstrakt klingen, doch der Autor gewinnt seine Ergebnisse, indem er die politische Praxis detailliert untersucht. Wie entstehen Gesetze? Wie werden Konflikte geregelt? Wer wird daran beteiligt? So wird sichtbar, wie zunehmend Reichsämter und Reichstagskommissionen zusammenarbeiteten und im Vorfeld Interessenorganisationen einbezogen wurden. Sichtbar wird auch, wie sich bei aller Dominanz Preußens dessen "Verreichung" und nicht eine "Ver-preußung" des Reiches vollzog.
Die Regierungsordnung des Reiches veränderte sich tiefgreifend, doch vieles blieb offen. Der Reichstag gewann enorm an Einfluss, ein parlamentarisches Regime, in dem die Regierung den Mehrheitsverhältnissen im Parlament entspricht, konnte er jedoch nicht durchsetzen, und die Integration der Sozialdemokratie wurde von der Reichsspitze verhindert. Diese Blockaden endeten erst im Weltkrieg, als es zu spät war, eine parlamentarische Monarchie zu etablieren.
Auch Haardt fragt nach dem Ort des Kaiserreichs "im Strom der Zeit", wenn er etwa Lehren für die Europäische Union ableitet. Hier ist er eine Stimme unter vielen. Doch nur im Schluss-kapitel. Die Hauptteile seines gewichtigen Werkes hingegen bieten die beste Gesamtdarstel-lung zum Regierungssystem des Deutschen Reichs und seines Wandels. Er schöpft aus einer breiten Forschungsliteratur, wertet zeitgenössische Beobachtungen und Analysen aus, insbe-sondere das staatsrechtliche Schrifttum, das die ungewöhnliche Konstruktion des jungen Staates zu bestimmen versuchte und höchst unterschiedliche Diagnosen stellte. Und er ver-folgt die Debatten im Reichstag und im Bundesrat einschließlich der vielen Ausschüsse, in denen Aushandlungsprozesse abliefen, die uns aus der Gegenwart geläufig sind. So erschließt sich das Entwicklungspotenzial, das in diesem Regierungssystem steckte. Wie es weitergegan-gen wäre, wenn die Niederlage im Ersten Weltkrieg und die Revolution nicht die Verhältnisse völlig verändert hätten, können wir nicht wissen.
Auch ein so vorzügliches Werk hat seine Grenzen. Um den Föderalismus des Kaiserreichs insgesamt in den Blick zu bekommen, müsste die Reichsebene ergänzt werden um die Glied-staaten und auch um die Kommunen. Dann würde das Bild dieses Staates noch bunter. Der Streit um seinen Ort in der deutschen Geschichte lebt in aller Regel davon, diese Vielfalt auszublenden. Eindeutigkeit hat ihren Preis.
Nota. - Das ist verdienstlich, dass die Darstellung eine Ebene wählt, wo die Quellen noch ihr Veto einlegen können. Doch so groß, wie der Rezensent meint, ist die Kluft zur 'großen Per-spektive' nicht. Man erkennt es an dem Schlüsselwort, das in dieser konkret-quellenmäßigen Arbeit auffällig fehlt: Bonapartismus.
Oder hat es der Rezensent bloß übersehen? Kaum anzunehmen, denn es weist der Bismarck-schen Hybride von vornherein einen Platz an im großen historischen Bogen: als eine Übergangs-erscheinung.
Zur Erinnerung: Als Bismarck für den Norddeutshcne Bund das allgemeine Wahlrecht aus der Tasche zog, war die politische Welt perplex. Nicht so Karl Marx, der den Achtzehnten Bru-maire geschschrieben hatte: Der wusste vorher, dass Bismarck das tun würde; tun musste.
Zum konkret-quellenmäßigen Teil gehört, dass in dem System, das Bismrck auf sich selbst zu-geschneidert hatte, die Stelle des Bonaparte doppelt besetzt war: Pro forma und zur Legiti-mation mit "Lehmann", wie Marx und Engels ihn nannten, und am Steuerruder der Kanzler. Dass Lehmanns Enkel ihn feuern sollte, konnte er sich nicht vorstellen. Aber hat er sich vorgestellt, dass die Konstruktion ihn und seinen König überleben würde?
Kaum anzunehmen. Das Reich war, gut bonapartistisch, durch den intrigant herbeigeführten Krieg entstanden und würde auf die Dauer wohl durch kleinere Waffengänge immer wieder-mal auf Vordermann gebracht werden müssen. Doch eine krachende Niederlage konnte es nicht überstehen.
Karl Liebknecht* hat immer wieder den bonapartistischen Chrakter des Weltkriegs auf deutscher Seite betont und die inneren Krisenerscheinungen im Lauf des Jahres 1913 hervorgehoben, die anzeigten, dass über den allgegenwärtigen Überdruss hinaus, der im Zauberberg und dem Mann ohne Eigenschaften bezeugt ist, die Grundlagen der Bismarck'-schen Konstruktion brüchig geworden waren. Während Frankreich Revanche wollte (und Elsaß-Lothringen), Russland den Bosporus, und auch England, das als einziges den Krieg hatte verhindeern wollen, seinen Appetit auf die Dardanellen entdeckte, als er dann doch gekommen war, hatte das, wie Bismarck sagte, "saturierte" Kaiserreich gar keine originären Kriegsziele - außer eben die Generalmobilmachung für Kaiser und Reich selbst.
Nun ist Bonapartismus keine Beschwörungsformel. Erklären kann der Begriff gar nichts, wenn man seine Voraussetzung nicht kennt. Es war die im Jahre 1848 ausgebliebene bürger-liche Revolution. Die Folge war eine unterworfene Bourgeoisie, die politisch mächtigen, vehe-ment anti-liberalen und antidemokratischen Ostelbier, und eine unaufhaltsam anwachsende Arbeiterbewegung. Mit den Agrariern, zu denen er selbst gehörte, auf der einen Seite und den parlamentarisch duchmarschierenden Sozialdemokraten auf der andern konnte er die Libera-len erpessen, wie er wollte.
Im selben Maße aber, wie Wilhelm II. - ähnlich übrigens wie Napoleon III. - die technisch-industrielle Entwicklung vorantrieb, stärkte er auch Industrie- und Bankkapital, und symme-trisch die Arbeiterbewegung. Dass der Untergang seines Reiches in eine proletarische Revolu-tion mündete, hatte seine historische Logik. Dass deren Niederlage dann weit verheerendere Folgen gezeitigt hat als das Jammerspiel von 1848 allerdings auch.
*) Gesammelte Reden und Schriften, Bd. IX, Berlin (O) 1971
JE
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen