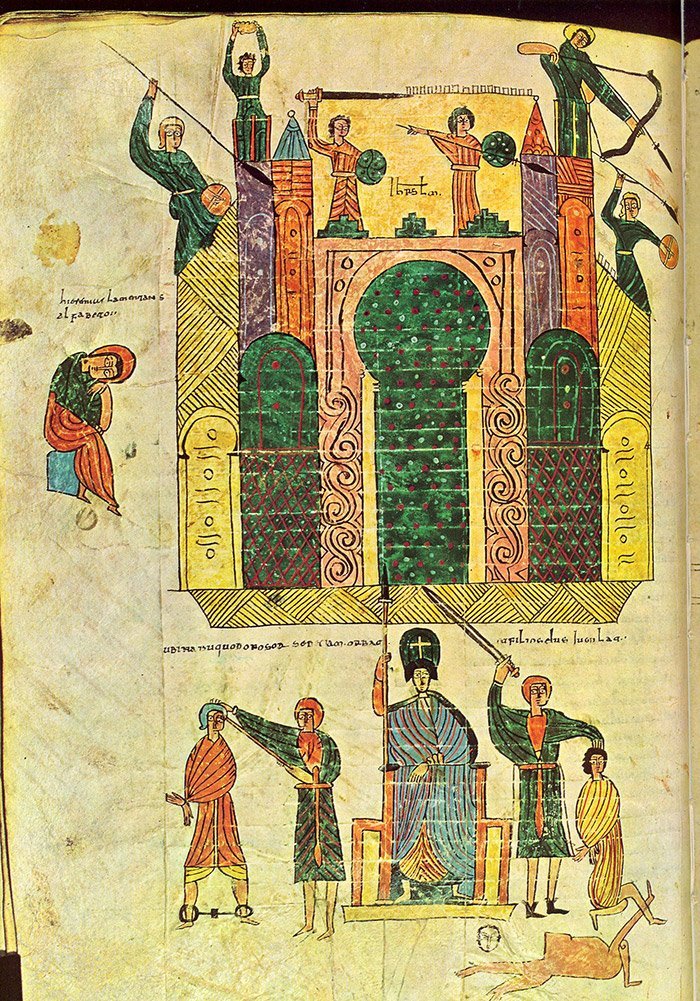«Den» Islam gibt es nicht
Muslime kennen viele Wege zur geistigen Erneuerung
Der
Mainstream-Islam ist heute ein Diktat der Politik. Dabei werden Muslime
als Opfer fremder Mächte dargestellt – eine Sicht, die sich viele
muslimische Communitys längst zu eigen gemacht haben. Das muss sich
ändern.
Islamexperten
haben sich lange darum bemüht, Nichtmuslimen zu erklären, dass es «den»
Islam nicht gibt. Viel wichtiger indes wäre es, unter Muslimen selbst
diesen Gedanken stärker zu verankern. Islam ist nicht gleich Islam, und
wer von der eigenen Vorstellung und Praxis abweicht, ist nicht gleich
ein schlechterer Muslim. Den einen «wahren» Islam mag es aus einer
göttlichen Perspektive geben, aber kein Mensch kann sich anmassen, ihn
ebenfalls zu kennen. Das beanspruchen nur Fundamentalisten, dünkelhafte
Gelehrte und blasierte Imame für sich.
Anfällig
für deren Avancen ist man vor allem dann, wenn man einen Leitfaden fürs
eigene Leben sucht – mit klaren Anweisungen. Man läuft vermeintlich
weisen Männern hinterher in der Hoffnung, die eigene Verantwortung im
Zweifelsfall auf sie abwälzen zu können. «Gehorchen ist leichter als
befehlen», wusste schon Friedrich Maximilian Klinger.
Viele Versionen des Islams
Sich
von vertrauten Gewissheiten aus der Kindheit abzunabeln, bedeutet
Abschied von Bequemlichkeit und Akzeptanz von Ungewissheit. Der Islam
ist eine anspruchsvolle Religion, die entgegen landläufigen
Vorstellungen keine einfachen Antworten liefert.
Weder
der Koran ist eindeutig noch die Erkenntnisse über das Leben des
Propheten Mohammed. Unzählige Schriften aus 1400 Jahren Islam zeugen
davon. Somit ist der Koran an sich ebenso wenig wie Mohammed das Problem
– das Problem ist der Anspruch einiger «auserwählter» Menschen, die
glauben, die islamischen Quellen allein wahrheitsgemäss auslegen zu
können.
Mangels
allgemeiner oberster Autorität gibt es in der islamischen Geschichte
bereits seit dem Ableben Mohammeds divergierende Auffassungen von der
«wahren» Religion. Inzwischen gilt der Islam vielen als
«Gesetzreligion», in der es primär um das Einhalten von Geboten und
Verboten geht. Doch das ist nur ein Verständnis vom Islam, das sich
insbesondere in den vergangenen 150 Jahren vielerorts durchgesetzt hat.
Es
wird zumeist von solchen propagiert, die Machtinteressen mit
Glaubensfragen verknüpfen; weshalb Islamisten oft zugleich
Fundamentalisten sind. Der Mainstream-Islam ist heute vor allem ein
Diktat der Politik. Überall auf der Welt spielen politische Interessen
in die gelebte Religion hinein.
Am
deutlichsten wird das in dem Versuch, den Niedergang der glorreichen
alten Welt im Kampf mit dem Westen wieder wettzumachen. Die Losung der
Islamisten, wonach der Islam die Lösung aller Probleme sei, prägt seit
Generationen das Denken zu vieler Musliminnen und Muslime – vor allem
dort, wo es ihnen im Alltag nicht so gut geht, also in etwa 90 Prozent
der islamischen Welt.
Viele
von ihnen fliehen vor diesen Zuständen in den Westen, wo sie sich trotz
vielfachen Dissonanzen Freiheit und Wohlstand erhoffen, und bringen
ihre religiösen Prägungen mit. Sofern noch nicht geschehen, müssen sich
Muslime unbedingt davon befreien, Religion von Politik reinigen und den
Zwang abstreifen, sich permanent als Opfer böser fremder Weltmächte zu
fühlen, die angeblich «den» Islam schwächen und «die» Muslime
kleinhalten wollten.
Schuld sind nicht die anderen
Auch
dieses islamistische Narrativ ist inzwischen tief in die muslimische
Community weltweit eingesickert – mit dem Ergebnis: Die Schuld wird
zuerst bei anderen gesucht. Um Teil der Religion des Islams sein zu
können, bedarf es eines hohen Masses an Toleranz für andere Positionen.
In der Vergangenheit hatten gläubige Muslime das vergleichsweise gut
eingeübt. Daran sollten sie anknüpfen und wieder mehr Selbstbewusstsein
im Umgang mit dem Koran, dem Leben des Propheten Mohammed und dem
Gelehrtenwissen aufbringen. Dazu bedarf es Mündigkeit, Emanzipation,
Vernunft.
Damit sind
die Schlagworte, die aufs Zeitalter der Aufklärung in Europa hinweisen,
gefallen. Dennoch ist «Aufklärung» hier der falsche Begriff, weil er
falsche Assoziationen weckt. Hört auf, den Islam und andere Religionen
durch die christliche Brille zu betrachten!
Die
Entwicklung der muslimischen Gemeinschaft ist eine andere als die der
katholischen Kirche. Hier versuchte eine Macht, der Vatikan im Pakt mit
weltlichen Führern, die Gläubigen zu beherrschen. Dort scheiterte ein
vergleichbarer Anspruch spätestens während der Abbasiden-Dynastie, weil
der Kalif zunehmend zum Grüssaugust degradiert wurde.
Im
Islam gibt es stattdessen einzelne Gruppierungen, konfessionelle
Abspaltungen, theologische Schulen, Rechtsschulen, Sekten, die mehr oder
weniger Dominanz für sich beanspruchen. Hinzu kommen vielfältige
kulturelle Unterschiede, die die Religionsvorstellungen zwischen
Hindukusch und Andalusien geprägt haben. In Indien etwa arrangierten
sich Muslime ungeachtet anderslautender Koranverse mit den sogenannten
«Götzendienern», während Muslime auf der Arabischen Halbinsel bis heute
eher eine radikale Ablehnung gegen sie predigen.
Solche
grundlegenden Differenzen verhindern es, die europäische Aufklärung
eins zu eins auf andere Kulturräume zu übertragen. Um das hervorzuheben,
habe ich schon des Öfteren betont: «Der» Islam braucht keine Aufklärung
im europäischen Sinn, aber Muslime müssen wieder Herr und Herrin über
ihre Vernunft werden und ihren Verstand in religiösen Fragen einsetzen.
Das
wäre keine Neuerung, dafür gibt es vielfältige Anknüpfungspunkte in der
Geschichte – etwa in Gestalt der Philosophen Alpharabius alias Abu Nasr
al-Farabi (gestorben 950) oder Averroes alias Ibn Ruschd (gest. 1198),
des religionskritischen Arztes und Freidenkers Rhazes alias Abu Bakr
al-Razi (gest. 925), des Korankommen- tators Fakhr al-Din al-Razi (gest.
1210), des Dichters al-Ma’arri (gest. 1057) – ein Skeptizist, der heute
als religions- bzw. islamfeindlich verfemt würde – oder in Gestalt
späterer Persönlichkeiten wie des islamischen Humanisten Murtada
al-Zabidi (gest. 1791) oder des ägyptischen
Beinah-Literaturnobelpreisträgers Taha Husain (gest. 1973).
Selbst
der Koran wird von Muslimen an verschiedenen Stellen so verstanden,
dass er Rationalität von den Menschen einfordert: «Und er lässt (seinen)
Zorn auf jene herab, die ihre Vernunft (dazu) nicht gebrauchen wollen.»
(Sure 10, Vers 100) Oder: «Wahrlich, darin liegen Zeichen für die
Leute, die Verstand haben.» (16, 12)
Lamya Kaddor ist Islamwissenschafterin und Publizistin.
Nota. - Der Islam steht wegen seiner theologischen Vieldeutigkeit - oder Leere, wie man's nimmt - vor dem Dilemma, 'mit sich identisch sein' zu können nur entweder als strikte Gesetzeslehre oder als eine Religion der reinen Innerlichkeit.
Als Gesetzeslehre kann er sich nicht 'aus der Politik lösen', er wird von der Politik beherrscht sein und die Po- litik beherrschen wollen - einen andern Inhalt hätte er dann ja nicht. Als Religion der Innerlichkeit wird er sich als Lehre (die er eo ipso gar nicht zu sein beanspruchen könnte) mit der Politik nicht einlassen. Dass der einzel- ne Muslim in der Welt wirksam wird, ist ja dabei nicht ausgeschlossen. Mystisch bewegte Gläubige haben, wie die höchstverschiedenen Meister Eckhart und der Emir Abd el-Kader, den Weg in die Öffentlichkeit gesucht und gefunden; auf seine Art auch al-Halladsch, der Vater der islamischen Mystik.
Allerdings neigen mystische Bewegungen dazu, einen Messias hervorzubringen, wie den Juden Sabbatai Zvi oder den sudanesischen Mahdi, dessen Bewegung nicht nur ein Aufstand gegen die britischen Fremdherrscher war, sondern auch eine sehr blutige fundamentalisische Gewaltorgie. Das ist das Eigentümliche mystischer Be- geisterung, dass sie keinen Lehrern folgt, sondern unberechenbaren Propheten. Eine rein innerliche Frömmig- keit hingegen wird den zeitgenössischn fanatischen Gestzeshütern wenig entgegensetzen können, nämlich nicht auf deren Terrain, der Öffentlichkeit.
JE