
aus spektrum.de, 23.11.2020 lpcinitiative
Geschichte der Indianer
Von
der ersten Besiedelung Amerikas über die Kolonialzeit bis heute: Eine
neue kompakte Gesamtdarstellung gibt Einblick in die vielschichtige
Vergangenheit der indigenen Bevölkerung Nordamerikas – fernab von
Klischees, wissenschaftlich fundiert und hochaktuell.
von Sebastian Hollstein
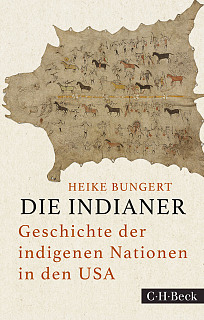
Es
fällt schwer, die Geschichte der Indianer nicht als eine Folge von
Betrug, Diskriminierung und gewaltsamer Vertreibung durch die
Euroamerikaner zu betrachten – auch nach der Lektüre dieser aktuellen,
informationsreichen und komprimierten Gesamtdarstellung. In mehr als der
Hälfte der 13 Kapitel spielen Auseinandersetzungen zwischen Indigenen
und den aus Europa stammenden Einwanderern und ihren
Nachfolgegenerationen – in der Regel mit negativen Konsequenzen für die
Indianer – eine gewichtige Rolle. Trotzdem gelingt Heike Bungert durch
ihre sachliche und wissenschaftliche Herangehensweise eine
vielschichtige Betrachtung.
Die
Historikerin von der Universität Münster und Expertin für
nordamerikanische Geschichte macht es sich zur Aufgabe, mit den
Indianern »keine passiven Opfer der Euroamerikaner oder Objekte«
darzustellen, sondern ihre Geschichte »als Interaktion verschiedener
indianischer und euroamerikanischer Kulturen mit daraus resultierender
Transformation aller Beteiligten« zu beschreiben.
Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt: Maya, Inka, Azteken – Die Hochkulturen Lateinamerikas
Kenntnisreich und souverän leitet die Autorin durch das enge Geflecht hunderter indianischer Völker und Gruppen. Zwei Karten im Anhang des Buchs helfen bei der Zuordnung der Siedlungsgebiete. Sie verzichtet auf Legenden und Pathos und ordnet prominente Indianer – wie Sitting Bull, Crazy Horse oder Pocahontas – in die historischen Gesamtzusammenhänge ein, anstatt sie besonders herauszuheben.
Bungert
schreibt aus einer neutralen Perspektive heraus und zeigt, dass die
ersten Zusammentreffen mit den Europäern nicht nur feindselig waren.
Beide Seiten versuchten, Vorteile aus der Begegnung zu ziehen. So
gewannen die Franzosen die Indigenen sowohl als wichtige Handelspartner,
etwa für Pelze, als auch als Verbündete gegen die Engländer. Dort, wo
sich nicht zu viele Europäer auf einmal niederließen, kam es durchaus
zum Kennenlernen, Austausch der Kulturen und zu Kooperation.
»Euroamerikaner und Indianer, aber auch indigene Gruppen untereinander
übernahmen kulturelle Praktiken ihrer Handelspartner, um Verständigung
und Überleben zu gewährleisten. So akzeptierten Europäer tagelange
Zusammenkünfte mit Reden, Gebeten, Tänzen und gemeinsamem Rauchen der
Kalumet-Pfeife und Austausch von Geschenken. Indianische Gruppen passten
Europäer in ihr Verwandtschaftssystem ein und bezeichneten den
französischen Gouverneur beispielsweise als ›Vater‹.«
Häufig
suchten Indianergruppen auf diese Weise Verbündete gegen ansässige
Konkurrenten. Das zeitweilige Einvernehmen, das vor allem auf die
zahlenmäßige Überlegenheit der Indigenen zurückzuführen ist, hatte
mitunter Auswirkungen auf ihre Lebensgewohnheiten. So übernahmen
Indianer importierte Gegenstände und Praktiken oder zogen in die Nähe
euroamerikanischer Siedlungen. Die Weißen dagegen verließen sich etwa
auf die Ortskenntnis und Versorgungsleistungen ihrer Nachbarn.
Ein friedliches Zusammenleben war häufig allerdings nur von
kurzer Dauer. Bereits früh drängten insbesondere die Engländer einzelne
indigene Gruppen weiter nach Westen. Gleichzeitig beteiligten sich
Indianer auf unterschiedlichen Seiten an euroamerikanisch initiierten
Konflikten, wie dem Krieg zwischen Engländern und Franzosen oder dem
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, und traten nicht als indigene
Einheit in Erscheinung.
Zeitweilige
Bündnisse mit den Eindringlingen konnte ihre Vertreibung jedoch nicht
verhindern. Bungert schildert detailliert, wie die Indianer über die
folgenden Jahrhunderte hinweg meist vergeblich versuchten, durch
Diplomatie, Gewalt sowie durch Anpassung ihrer Lebensweise, die eigenen
Siedlungsgebiete und Lebensweisen zu bewahren, und wie sie unter der
aufkommenden Entwurzelung litten. »Die psychologischen Folgen für
Gruppen, die wie die Winnebagos siebenmal in 30 Jahren migrieren
mussten, lassen sich kaum abschätzen«, schreibt die Autorin. Ende des
19. Jahrhunderts lebten nahezu alle Angehörigen der indigenen
Bevölkerung in Reservaten.
Besonders informativ – da seltener behandelt – sind die beiden Abschnitte, die den Zeitraum zwischen der Ankunft der Weißen und dem Ende der Indianerkriege 1890 einrahmen. Ab etwa 14 000 v. Chr. gelangten die indianischen Vorfahren vermutlich in mehreren Wellen aus Nordsibirien und dem nordöstlichen Teil Asiens über eine Landzunge nach Nordamerika. Skelettfunde wie die »Buhl Woman« aus Idaho und der »Kennewick Man« aus dem Staat Washington unterstützen diese These.
Erste landwirtschaftlich geprägte Kulturen wie die
Hohokam, die zwischen dem 6. und 14. Jahrhundert im Südwesten Mais,
Kürbisse und Baumwolle anbauten und dabei viel Aufwand für die
Bewässerung ihrer Felder betrieben, siedelten sesshaft in größeren
Dörfern. Mississippi-Kulturen im Südosten brachten sogar so genannte
Chiefdoms hervor, wie Cahokia in der Nähe des heutigen St. Louis. In den
stadtähnlichen Verwaltungseinheiten sowie wirtschaftlichen und
religiösen Zentren lebten tausende Menschen zusammen.
In einem Kapitel gibt Bungert zudem spannende Einblicke in
die vielfältigen Gesellschaftsstrukturen und die religiösen
Vorstellungen der Indigenen kurz vor der Ankunft der Europäer. So
verweist sie beispielsweise auf die weit verbreitete Matrilinearität,
also die Ausrichtung der Abstammung einer Familie auf die Ehefrau.
In den abschließenden Kapiteln beschreibt die Autorin ein langes Jahrhundert bis in die Gegenwart, in dem sich die Indianer gegen Diskriminierung, assimilatorische Initiativen und kulturelle Auslöschung zur Wehr setzten und unter anderem durch panindianische Bürgerrechtsbewegungen Souveränität und einen Platz in der amerikanischen Gesellschaft für ihre Nationen erkämpften. Ihre Lebensumstände sind allerdings bis heute von einer schwierigen Beziehung zu den USA und damit einhergehender Benachteiligung geprägt – Armut, Arbeitslosigkeit und Unterversorgung kennzeichnen das Leben in vielen Reservaten.
Nota. - So wenig wie die Germanen gegenüber den Römern, verstanden sich die indianischen Stämme gegenüber den eindringenden Europäern als eine Einheit. Folglich hatten sie keinen Namen für sich und müssen bis heute mit der Bezeichnung leben, die jene ihnen gaben. So hat die Autorin als Historikerin guten Grund, von Indianern zu sprechen und nicht von Native Americans - wie People Without Color sie inzwischen umzutaufen belieben.
JE
Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen