
Montag, 30. November 2020
Die Freimaurer.

Und «mächtig»? Das waren (und sind) die Freimaurer vor allem in den Augen ihrer Gegner, die ihnen seit der Französischen Revolution praktisch jedes Übel der Geschichte angedichtet haben, einschliesslich der Jack-the-Ripper-Morde. Sehr wohl aber kann man die Bruderschaft als «einflussreich» bezeichnen, und ebendarauf zielt der Untertitel der Originalausgabe: «How the Freemasons Made the Modern World».
Etwa sechs Millionen Freimaurer gebe es heute auf der Welt, berichtet John Dickie im Vorwort. Zu ihren Glanzzeiten waren es um ein Vielfaches mehr, mit einer stattlichen Liste an Berühmtheiten, unter ihnen Goethe, Mozart und Casanova, George Washington, Winston Churchill und Franklin D. Roosevelt, Henry Ford und Walt Disney, ja sogar Arthur Conan Doyle oder Oliver Hardy. Aber noch so viele prominente Namen verhindern nicht, dass der Londoner Historiker mit seinem Gegenstand ein Problem hat: Die Freimaurerei selbst ist nur halb so aufregend wie ihre Geschichte und die sich um sie rankenden Verschwörungsmythen.
Wohl deshalb legt John Dickie, der Autor eines vorzüglichen Buches über die Cosa Nostra, schon im zweiten Kapitel die Karten auf den Tisch. Im Schnellgang und mit der angemessenen spöttischen Distanz resümiert Dickie alle heute längst bekannten «Geheimnisse» der Bruderschaft wie ihren bis zum Tempel Salomons zurückreichenden Entstehungsmythos oder die bizarr anmutenden Aufnahmerituale mit verbundenen Augen und hochgekrempeltem Hosenbein.
Dabei sei die Androhung drakonischer Strafen bei Verrat, wie das Herausreissen der Zunge, stets blosser «Theaterdonner» gewesen, so Dickie, und überhaupt: «Mehr steckt nicht dahinter», denn «die Wahrheit über die Freimaurerei» sei «absolut banal». Einerseits. Andererseits erzeugte das Versprechen, beim Aufstieg vom Lehrling zum Meister Zugang zu immer geheimeren Wahrheiten zu erhalten, auch eine enorme Anziehungskraft; sie war es, die die Freimaurerei zu einem «der erfolgreichsten kulturellen Exportgüter Grossbritanniens» machte.
Denn auf der Insel ist die Bruderschaft entstanden: Nach einer verwickelten Vorgeschichte im Schottland der Renaissance wurde 1717 in der Londoner Gaststätte «Goose and Gridiron» («Gans und Bratrost») die erste Grossloge gegründet. Attraktiv, zumal in Zeiten politischer und religiöser Spannungen, seien die Logen auch deshalb gewesen, weil in ihnen Politik und Religion von Anfang an tabu waren. Und weil sich die Mitglieder, Bürger und Aristokraten, in einem geschützten Raum ständeübergreifend auf Augenhöhe austauschen konnten. Durch die Einübung von Toleranz, Diskursfähigkeit und Demokratie (die gewählte Führung einer Loge wechselt alle zwei Jahre) hätten die Maurer ihren Teil zur Entstehung einer modernen, egalitären Gesellschaft beigetragen, betont der Historiker.
Der «Verschwiegenheitskult» der Brüder war für Aussenstehende aber nicht nur faszinierend, er rief auch Misstrauen hervor. Vor allem bei der Kirche, die seit einer Bulle von Papst Clemens XII. 1738 (bestätigt 1983 vom damaligen Kardinal Ratzinger) für eine Zugehörigkeit zu den Maurern die Exkommunikation vorsieht. Die Kirche verdächtigte die Brüder des Satanismus und, weil Frauen der Zutritt zu den Logen verwehrt blieb, der Sodomie. Eine Unterstellung, bei der sich John Dickie die Gelegenheit zu einem Seitenhieb nicht entgehen lässt: «Vielen dürfte angesichts solcher Anschuldigungen der Gedanke kommen, dass die Kirche in puncto sexuelle Perversion eventuell im Glashaus sitzt.»
Seit je haben sich die Freimaurer als exklusiv männliche Gesellschaft verstanden, erst in jüngster Zeit wird dieser Ansatz zaghaft aufgeweicht. Von Ausnahmen wie den gemischtgeschlechtlichen «Adoptionslogen» im vorrevolutionären Frankreich abgesehen, standen die Rollen für Frauen fest: «pflichtbewusste Ehefrauen. Totems männlicher Ehrbarkeit. Mitleidige Engel. Witwen, die der Fürsorge bedürfen. Zuschauerinnen bei kostümierten männlichen Spektakeln». Bedenkt man, dass Freimaurer sich selbst so blumige Titel wie «Ritter des Argonautenordens» verleihen, erscheint Dickies Vorschlag naheliegend, die freimaurerische Geschichte auf die Formel «vier Jahrhunderte männlicher Überspanntheit» zu bringen.
Der Historiker nähert sich seinem Gegenstand aber nicht nur mit mildem Spott, sondern auch mit einer gehörigen Portion Sympathie. Zugleich stösst er aber beim (mitunter sehr kleinteilig erzählten) Gang durch die Geschichte immer wieder auf Widersprüche zwischen maurerischen Werten wie Gleichheit, Brüderlichkeit, Weltoffenheit und Humanität und der Realität. Wie in Britisch-Indien, wo Rudyard Kipling schmeichelhafte Lobgesänge auf die Logen dichtete, in denen sich Briten und Angehörige des Kolonialvolks angeblich brüderlich begegneten. Oder in Italien, wo die Freimaurerei schon seit der Ära Napoleons auf unselige Weise mit der Politik verstrickt war.
Der deutschen Freimaurerei wirft Dickie ein geschöntes Selbstbild als Opfer der NS-Zeit vor: Zwar wurden die deutschen Logen nach 1933 tatsächlich verboten, aber zuvor hätten die meisten alles versucht, sich den Nazis als loyale Stütze des neuen Staates anzudienen, und ihre jüdischen Mitglieder gar nicht schnell genug loswerden können. Besonders erhellend wird Dickies Darstellung aber im Fall der USA, wo die Freimaurerei nach dem Ersten Weltkrieg so populär war, dass eine Mitgliedschaft für Geschäftsmänner «zur Visitenkarte für Glaubwürdigkeit und korrektes Geschäftsgebaren» wurde.
Für Weisse zumindest, denn Afroamerikanern blieb der Zutritt verwehrt: «Die masonische Utopie steht allen offen», so Dickie lakonisch. «Nur nicht den Unerwünschten.» Die von Schwarzen schon Ende des 18. Jahrhunderts begründete Tradition der Prince-Hall-Freimaurerei, mit grossen Namen wie Nat King Cole, Sugar Ray Robinson oder Thurgood Marshall, dem ersten schwarzen Richter am Supreme Court, werde bis heute von vielen weissen Grosslogen der USA nicht anerkannt, all ihren Verdiensten um die Bürgerrechtsbewegung zum Trotz.
John Dickie: Die Freimaurer. Der mächtigste Geheimbund der Welt. Aus dem Englischen von Irmengard Gabler. Verlag S. Fischer, Frankfurt am Main 2020. 560 S., Fr. 37.90.
Nota. - Giuseppe Balsamo alias Graf Cagliostro findet keine Erwähnung; nicht in der Re-zension, aber doch hoffentlich im rezensierten Buch. Niemals war nämlich die Maurerei kulturhistorisch bedeutsamer als unmittelbar vor und ein paar Jahre nach der französischen Revolution. Nicht nur Friedrich II. von Preußen, sondern auch Joseph II. von Österreich gehörten ihr an, letzterer neben Mozart den Illuminaten. Viel wurde gemutmaßt über dessen letzten großen Erfolg, die Zauberflöte, die doch von nichts anderm handelt als von der Be-freiung der menschlichen Seele (Pamina) durch den freien Geist (Tamino) aus den Fängen der römischen Kirche (Königin der Nacht) unter Anleitung der illuminierten Weisheit: Sarastro.
Die Wirklichkeit der Revolution besorgte dann Ernüchterung. In ihrem Alltag war die Maure-rei seither vor allem ein entspannter Ort, wo Geschäftsleute sich ohne Blick auf den Markt, aber nicht ganz ohne Rücksicht auf praktischen Nutzen treffen konnten.
Der idealistische Philosoph Fichte, natürlich selber Freimaurer, dachte jedoch nach dem Scheitern seiner Lehrtätigkeit in Jena daran, die Freimaurerei in eine Gelehrtenverschwörung umzubilden, die der Herrschaft der Vernunft in der bürgerlichen Gesellschaft den Weg be-reiten sollte - als eine geistige Avantgarde, die manchem als Keimform der Marx'schen revo-lutionären Partei erscheinen könnte.
JE
Samstag, 28. November 2020
Zum 200. Geburtstag von Friedrich Engels.
 um 1850
um 1850aus nzz.ch, 27.11.2020
Er beherrscht ein Dutzend Sprachen aktiv und zahlreiche weitere passiv. Als Autodidakt macht er sich auf mehreren Gebieten einen Namen. Er schreibt für Journale weltweit, so auch für die «New York Tribune», die der frisch gegründeten Republikanischen Partei nahesteht und mit ihr die Sklaverei bekämpft. Seine intimen Kenntnisse des Militärwesens tragen ihm den Spitznamen «General» ein.
Als Kaufmannsgehilfe bringt er einen promovierten Philosophen dazu, sich Hals über Kopf in die politische Ökonomie zu stürzen. Das als Folge davon entstehende Werk, als dessen stiller Teilhaber er sich im gemeinsamen «Compagniegeschäft» fühlt, prägt wie kein anderes das 20. Jahrhundert. Schon zu Lebzeiten avancieren die Kompagnons zu Galionsfiguren des Sozialismus, danach zu dessen Säulenheiligen.
Am 28. November 2020 wäre Friedrich Engels 200 Jahre alt geworden. Seinem zum Pietismus neigenden Vater, Textilfabrikant in Barmen (heute Wuppertal), missfallen die humanistischen und liberalen Anwandlungen des begabten Schülers. Ein Jahr vor dem Abitur steckt er ihn zur Lehre in die eigene Firma. Friedrichs Radikalisierung nimmt ihren Lauf. Ihn empören das soziale Elend der Arbeiterschaft und die Selbstgewissheit und stählerne Härte der Fabrikanten.
Er verschlingt die Schriften französischer Früh- und utopischer Sozialisten. Seine Ausbildung als Kaufmann komplettiert er von 1842 bis 1844 in einer Fabrik bei Manchester, deren Miteigentümer sein Vater ist. Er lernt das Fabriksystem, eine moderne Form der «Sklaverei», und den Handel von der Pike auf kennen und entwickelt eine tiefe Abneigung gegenüber dem Gewerbe und der Frömmelei seiner Betreiber.
In der Kuppel der Manchester Cotton Exchange heisst es offenbar nicht grundlos: «Who would find eternal treasure, must use no guile in weight or measure.» Engels nimmt Kontakt zu Sozialisten und Chartisten um Robert Owen auf, liest die Schriften der ricardianischen Sozialisten und die Werke der klassischen Ökonomen Adam Smith und David Ricardo. Bei Besuchen von Fabriken und Wohnvierteln der Arbeiterschaft studiert er deren Arbeits- und Lebensbedingungen.
Zurück in Barmen, veröffentlicht er 1845 «Die Lage der arbeitenden Klasse in England», ein Pionierwerk der empirischen Sozialforschung. Darin, so Papst Benedikt XVI. in der Enzyklika «Spe Salvi» von 2007, werde das Los der Industriearbeiter «in einer erschütternden Weise geschildert».
Aber nicht nur einen Papst beeindruckt Engels. Sein in Manchester verfasster Essay «Umrisse zu einer Kritik der Nationalökonomie» erscheint 1844 in den von Marx mitherausgegebenen «Deutsch-Französischen Jahrbüchern». Marx nennt ihn eine «geniale Skizze» und wendet sich der politischen Ökonomie zu, um das «Bewegungsgesetz der modernen Gesellschaft» zu entschlüsseln.
Im Essay rechnet der gerade 23-jährige Engels ungestüm mit der «Bereicherungswissenschaft» ab. Entstanden «aus dem gegenseitigen Neid und der Habgier der Kaufleute», trage sie «das Gepräge der ekelhaftesten Selbstsucht auf der Stirne». Ihre Vertreter, allesamt «Heuchler», suchten «unsittliche» Verhältnisse zu legitimieren. Was aber ist die Ursache der untragbaren Zustände, und wie sind diese zu überwinden? Es gehe um nichts Geringeres als um die Schicksalsfrage der Menschheit – um die «Versöhnung der Menschheit mit der Natur und mit sich selbst».
Das Grundübel, darin stimmt Engels Pierre-Joseph Proudhon zu, sei das Privateigentum. Es bewirke Markt und Konkurrenz und sei verantwortlich für Not und Elend der Arbeiterklasse. Nur seine Abschaffung erlaube die Rückkehr zu einer sittlichen Sozialordnung der Gleichen und Freien, wie sie in früheren Stammesgesellschaften geherrscht habe.
Aber besteht Grund zur Hoffnung? Engels ist optimistisch: Die «totale Umgestaltung der sozialen Verhältnisse», Ergebnis der Selbsttransformation der Gesellschaft, stehe unmittelbar bevor. Mit der Einführung von Gemeineigentum reinige sich die Welt von der Sünde. Engels argumentiert wie folgt: Der gesellschaftliche Antagonismus spitze sich im Lauf der Zeit zu. Einer kleinen, ständig reicher werdenden besitzenden Klasse stehe eine wachsende Klasse von «Proletariern» und «paupers» gegenüber.
Periodische Handelskrisen und technologisch bedingte Arbeitslosigkeit verstärkten den Konflikt, bis dieser sich schliesslich in einer «sozialen Revolution» entlade. Das Versagen der Ökonomen werde offenkundig. Besonders empört Engels die Bevölkerungstheorie des anglikanischen Pfarrers und Ökonomen Thomas Robert Malthus, der Arme und Elende für ihr Schicksal selbst verantwortlich macht.
Dies sei der Gipfel christlicher Frivolität und zudem blanker Unsinn. Kein allgemeiner Mangel an Unterhaltsmitteln sei das Problem, wie Malthus mit seiner Lehre von den abnehmenden Ertragszuwächsen in der Landwirtschaft und überschiessendem Bevölkerungswachstum behaupte. Schon das Nebeneinander von Armut und Elend und Reichtum und Überfluss strafe seine Sicht Lügen.
Das Problem sei die ungerechte Verteilung des gesellschaftlichen Reichtums. Malthus unterschätze aufs Ärgste die von Wissenschaft und Technik ermöglichte Steigerung der Arbeitsproduktivität: «Die Wissenschaft aber vermehrt sich mindestens wie die Bevölkerung [. . .] in geometrischer Progression – und was ist der Wissenschaft unmöglich?»
Der apokalyptische Reiter Malthus jage einem Hirngespinst nach! Bei laufend steigender Produktivität verlören die Probleme der Güterknappheit und Verteilungsgerechtigkeit an Bedeutung. Die Ausbeutung von Menschen durch Menschen sowie der Besitzindividualismus stürben ab. Engels, der glühende Fortschrittsoptimist, singt ein Hohelied auf die grossen Erfinder des Industriezeitalters.
Auf die Frage, wie Produktion und Verteilung ohne Märkte in grossen, arbeitsteiligen Gesellschaften im Unterschied zu Stammesgesellschaften zu organisieren seien, kommt Engels wiederholt zu sprechen. So auch in seiner 1884 veröffentlichten Schrift «Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und des Staats». Zwar erkennt er scharfsinnig die sich ergebenden Informations- und Koordinationsprobleme, aber irgendwie hofft er darauf, diese würden sich von selbst lösen. Im Essay belässt er es bei dem gutgemeinten, aber naiven Rat: «Produziert mit Bewusstsein, als Menschen, nicht als zersplitterte Atome ohne Gattungsbewusstsein.»
1844 besucht er Marx in Paris. Es ist der Beginn einer lebenslangen engen Freundschaft und einer intellektuellen und politischen Zusammenarbeit. Zusammen mit Marx verfasst er mehrere Streitschriften und dann 1848 im Auftrag des gerade in London gegründeten Bundes der Kommunisten das «Manifest der Kommunistischen Partei».
Dieses enthält unter anderem eine Analyse der ungeheuren Dynamik des schliesslich die ganze Welt umspannenden Kapitalismus, der auch Kritiker nicht die Anerkennung versagen. Zunächst nur in kleinem Kreis zirkulierend, entfaltet das Manifest gegen Ende des Jahrhunderts eine wachsende politische Wirkung.
Im Lauf seiner Beschäftigung mit der politischen Ökonomie entwickelt Marx einige der in den «Umrissen» enthaltenen Überlegungen und verwirft andere. Seine Unterscheidung zwischen «klassischen» und «Vulgärökonomen» unterminiert das Pauschalurteil seines Freundes: Ersteren zollt er merkliche Hochachtung ob ihrer Untersuchung der «Physiologie der bürgerlichen Gesellschaft», während Letztere sich nur an der «Oberfläche der Phänomene» herumtrieben. Über das Schicksal der kapitalistischen Produktionsweise entscheide die langfristige Tendenz der allgemeinen Profitrate, ein zentrales Konzept, das in Engels’ Essay nicht vorkommt.
Engels arbeitet als politischer Publizist, bis ihn 1850 die Firma Ermen & Engels als Angestellten verpflichtet. 1864 wird er Teilhaber der Firma, scheidet aber aus der aktiven Arbeit 1869 und als Teilhaber 1875 aus, danach lebt er als Rentier und Börsianer. Während all der Jahre unterstützt er Marx und dessen Familie finanziell.
Im Verlauf der Zeit äussert er sich zu einem bunten Strauss von Themen, darunter zum gescheiterten deutschen Bauernaufstand von 1525, zum Krimkrieg, zur indischen Revolution, zum amerikanischen Sezessionskrieg, zur Wohnungsfrage, zur deutschen Reichsverfassungs-kampagne, zur Entwicklung von Waffentechnik und zu militärischer Taktik und Strategie und schliesslich auch zur materialistischen Philosophie. Und er setzt sich für die Rechte der Frauen ein. In der Schrift «Die Entwicklung des Sozialismus von der Utopie zur Wissenschaft» (1880) propagiert er das Konzept des «wissenschaftlichen Sozialismus».
Marx spornt er dazu an, endlich die Bände II und III des «Kapitals» fertigzustellen. Aber die Vollendung des Opus magnum will diesem nicht gelingen. Als Engels nach dem Tod des Freundes 1883 dessen literarischen Nachlass sichtet, muss er erkennen, dass Marx bezüglich einiger Teile seiner gewaltigen Konstruktion Zweifel gekommen sind und er sich festgebissen hatte. Insbesondere: War die Begründung einer tendenziell fallenden Profitrate wirklich stichhaltig?
Engels oblag es, aus dem Berg an Manuskripten und Fragmenten zwei einigermassen kohärente Bände zu formen. Fast zehn Jahre härtester editorischer Arbeit waren nötig, um die Aufgabe zu bewältigen: 1885 erscheint Band II, 1894 Band III des «Kapitals». In Übergängen und Anmerkungen, die er in den Text einfügt, hegt Engels das von Marx gelegentlich gezeigte Zaudern ein, wohl um keine Zweifel an der politischen Mission aufkommen zu lassen. Er wird seine Interventionen als zulässigen Freundschaftsdienst verstanden haben, als Arbeit am Lebenswerk des übermächtigen Freundes, in dessen Schatten er ein Leben lang stand – zu Unrecht. Engels stirbt am 5. August 1895 in London.
Als
Einführung ins Werk von Friedrich Engels empfehlen sich: E. Illner,
H. Frambach und N. Koubek (Hg.): Friedrich Engels. Das rot-schwarze
Chamäleon. Wissenschaftliche Buchgesellschaft Darmstadt, Darmstadt 2020.
R. Lucas,
R. Pfriem und H.-D. Westhoff (Hg.): Arbeiten am Widerspruch – Friedrich
Engels zum 200. Geburtstag. Metropolis-Verlag, Marburg 2020.
Heinz D. Kurz ist Professor für Volkswirtschaftslehre an der Karl-Franzens-Universität Graz und Fellow des Graz Schumpeter Centre.
Nota. - 'Die Reinigung der Welt von der Sünde' - da steckt mehr hinter als diese Kurzskizze ahnen lässt. Marx ist tatsächlich auf dem Weg der reinen Ideen zur Revolution gelangt; bei Engels aber steckte ein existenzielles Motiv dahinter. Sein verhasster hartherziger Vater war ein besonders bigotter Vertreter des wuppertalschen Pietismus, und zugleich ein Kapitalist ohne Skrupel. Prof. Kurz wollte dem biographischen Detail zurecht nicht zuviel Gewicht beimes-sen. Aber ganz unterwähnt muss es in Sachen Sünde nicht bleiben, denn Heuchelei ist deren schändlichste.
JE
Freitag, 27. November 2020
Röttgen vor Laschet.
aus welt.de, 27. 11. 2020
... Im Ringen um den CDU-Vorsitz bleibt der frühere Fraktionschef Friedrich Merz mit einem Zustimmungswert von 27 Prozent vorn, allerdings mit einem deutlichen Verlust von acht Prozentpunkten. Verbessern kann sich Ex-Umweltminister Norbert Röttgen mit 16 Prozent (plus vier), während NRW-Ministerpräsident Armin Laschet auf 15 Prozent zurückfällt (minus neun).
Ähnlich ist das Bild unter den CDU-Anhängern. Auch hier liegt Merz mit 39 Prozent vorn, gefolgt von Röttgen mit 22 Prozent und Laschet mit 15 Prozent. Die übrigen Befragten wünschen sich jeweils einen anderen Bewerber oder eine andere Bewerberin. ...
Nota. - Wer nur alle fünf Sinne beisammen hat, kann es nicht übersehen: Deutschland braucht keine Wende, sondern eine Fortführung der Ära Merkel; und zwar nicht verwässert, sondern eher mit neuem Offensivgeist und mehr Konfliktbereitschaft als bisher. Von welchem Kandi-daten ist das zu erwarten? Nein, von Laschet nicht, der Untote fällt sowieso aus. Bleibt nur Einer. Und wenn der Vorsitzender würde, könnte nichtmal ein Untoter sagen, das hätte das Parteiestablishment so gedeichselt.
JE
Donnerstag, 26. November 2020
Kreuz und quer denken.
 Wander Impressionen aus Philosophierungen
Wander Impressionen aus PhilosophierungenQuerdenken.
Querdenken ist keine Tugend. Am
besten denkt man doch immer noch geradeaus, solange es geht, dann kann
man auch stets überblicken, woher man kommt; denn wie sollte man sonst
wissen, wo man ist?
Manchmal gerät man in ein Gestrüpp,
da muss man wohl auch mal um die Ecke denken. Doch wenn der Knoten zu
dicht wird, braucht man ein Alexanderschwert.
Dann gehts weiter gradaus.
30. 8. 14
Mittwoch, 25. November 2020
Diversity ist nicht links.
 bild
bildaus Tagesspiegel.de, 22. 11. 2020
von Michael Bröning
In der Wahlforschung galt jahrzehntelang als ausgemacht: Menschen mit Migrationshintergrund, Neueinwanderer und sichtbare Minderheiten wählen links. Im Vereinigten Königreich etwa unterstützen Ende der 1990er Jahre annähernd 90 Prozent der „ethnischen Minderheiten“ die Labour Party.
In den Vereinigten Staaten wurde Barack Obama 2008 von rund 90 Prozent der Black Votes ins Weiße Haus entsandt und auch in Mittel- und Nordeuropa galt die Stimmabgabe von Einwanderern und ihren Nachkommen für Mittelinksparteien über ein halbes Jahrhundert lang als ehernes Gesetz.
Die verbreitetste Erklärung: Gerade neue Einwanderer sowie diskriminierte Minderheiten seien besonders an sozialer Unterstützung, einer Verteilung des Wohlstandes und nicht zuletzt an einer weltoffenen Ausrichtung ihrer neuen Heimat interessiert. So verstanden, spiegelte die Unterstützung linker Parteien ein wohlverstandenes Eigeninteresse.
In der Realität aber führte diese Vermählung mit der Linken bisweilen zu einem Paradox: Manch ein Wähler, der etwa in Mitteleuropa für progressiv-säkulare Parteien stimmte, unterstützte im Herkunftsland beharrlich religiös-konservative Kräfte. Das Resultat: Parteianhänger, die zwar links wählten, aber bezogen auf zentrale soziokulturelle Werte wie die Frage der Gleichbehandlung der Geschlechter nicht links waren.
Die Neigung von Einwanderern nach links ist kein aktuelles Phänomen. Schon 1787 warnte Thomas Jefferson, dass Einwanderer „die Prinzipien der Regierungen, die sie hinter sich lassen“ ins Land importierten – eine These, die noch heute gerne auf der Rechten zitiert wird. Im Sommer dieses Jahre etwa fragte das konservative Cato-Institut in den USA besorgt, wie sehr Einwanderer des 20. Jahrhunderts die Vereinigten Staaten ideologisch nach links gerückt hätten. Die Umsetzung des New Deal erscheint darin als Konsequenz der wohlfahrtstaatlichen Neigungen europäischer Auswanderer.
Angesichts der wachsenden Bedeutung der nicht-weißen Wählerschaften in westlichen Demokratien wird die Frage der politischen Ausrichtung von Minderheiten immer relevanter. In den USA sind über 23 Millionen Wahlberechtigte direkte Einwanderer. Und in Deutschland betrug der Anteil von Wählern mit Migrationshintergrund in der letzten Bundestagswahl immerhin rund 10 Prozent.
Das historische Arrangement mit der Linken scheint brüchig zu werden - und zwar weltweit. In den zurückliegenden US-Präsidentschaftswahlen wurde dies besonders deutlich: Eine Vielzahl von Latinos und schwarzen Wählern unterstützte nicht Joe Biden, sondern votierte für den Amtsinhaber.
Zwar hielt eine große Mehrzahl den Demokraten die Treue, doch selbst 35 Prozent der muslimischen Wähler stimmten für Trump – ebenso wie fast ein Drittel der asiatisch-stämmigen Amerikaner. Ein progressiver Block der People of Color erwies sich als Chimäre.
Der Trend ist nicht neu: Schon vor vier Jahren hatten Wahlforscher auf den überraschend starken Rückhalt verwiesen, den Trump in der kubanischen Community oder unter vietnamesischen Amerikanern genoss. Eine vergleichbarere Entwicklung findet auch außerhalb der Vereinigten Staaten statt.
Im Vereinigtes Königreich etwa ist der Anteil der Labour-Unterstützer unter schwarzen Wählern und ethnischen Minderheiten im zurückliegenden Wahljahr auf 64 Prozent zurückgegangen. Zwar ist das immer noch eine stattliche Mehrheit, aber zugleich eben auch ein Einbruch von rund 20 Prozentpunkten in zwei Jahrzehnten.
Und in Frankreich? Dort ist die jahrzehntealte Unterstützung der Parti Socialiste durch muslimische Wähler ebenfalls weitgehend Geschichte. Wurde der sozialistische Präsidentschaftskandidat François Hollande 2012 im zweiten Wahlgang noch von 86 Prozent der Muslime gewählt, fiel dieser Anteil in den Präsidentschaftswahlen vor drei Jahren auf unter 20 Prozent.
Selbst in Neuseeland erweist sich die These vom links wählenden Einwanderer als überholt. In den Wahlen im Oktober neigte eine Mehrheit der zahlenmäßig besonders starken chinesischen Einwanderer nicht der progressiven Jacinda Ardern zu, sondern ihrer konservativen Rivalin Judith Collins. Warum ist das so?
Entscheidend erscheint hier der Faktor Zeit. Untersuchungen aus den Vereinigten Staaten belegen, dass der Zeitpunkt der Einwanderung für das Wahlverhalten entscheidend ist. Je weiter die eigene Migrationserfahrung in der Vergangenheit liegt, desto stärker nähert sich das Wahlverhalten an die Ursprungsgesellschaft an. So betrachtet, erscheint die Abwendung vom linken Automatismus als paradoxes Indiz für den Erfolg der politischen Integration.
Schließlich scheint der politische Orientierungswechsel für manche Wähler den Wandel der eigenen Wahrnehmung hin zum arrivierten Staatsbürger zu illustrieren. Und: In Zeiten, in denen Milieus auch in der Mehrheitsgesellschaft volatiler werden, differenziert sich eben auch das Wahlverhalten von Einwanderern und Minderheiten weiter aus.
Dabei scheinen gerade kulturelle Fragen stärkere Bedeutung zu erlangen. So dürfte sich in den USA etwa die skeptische Sicht konservativer Christen aus Lateinamerika auf liberale Abtreibungspraktiken negativ auf die Strahlkraft der Demokraten ausgewirkt haben. In Frankreich hingegen trieb nicht zuletzt der sozialistische Einsatz für die gleichgeschlechtliche Ehe einen massiven Keil zwischen kulturkonservative Muslime und die linke Mitte.
Der Spagat aus wertekonservativen migrantischen Wählern und progressiver Parteiprogrammatik gerade in identitätspolitischen Themen ließ sich letztendlich nicht durchhalten.Dabei gilt aber auch: Innerhalb der Minoritäten sind die politischen Unterschiede oft stärker ausgeprägt als die zur Mehrheitsgesellschaft. Nicht zuletzt das scheint der Grund dafür zu sein, dass sich spezifische Parteien für Minderheiten in westlichen Demokratien bislang nicht durchsetzen konnten.
Zwar wirbt in den Niederlanden seit 2015 die Partei „Denk“ dezidiert um türkischstämmige Wähler. Und auch in Frankreich bemüht sich eine Union des Démocrates Musulmans Français um muslimische Stimmen auf der Linken. Die Resonanz aber ist dürftig. In den Niederlanden liegt Denk im niedrig einstelligen Bereich. In Frankreich kam die Muslimpartei in den Europawahlen auf gerade mal 0,13 Prozent.
Auch diese Ergebnisse belegen: Einwanderer und ihre Nachkommen sind kein einheitlicher Block. Insbesondere der Mythos der automatisch linken Minderheitenstimme entspricht nur noch eingeschränkt der Wirklichkeit. Offensichtlich kann sich manch ein Politanalyst Wählerinnen und Wähler mit Migrationshintergrund und Angehörige ethnischer Minderheiten nur als Gefangene ihrer eigenen Biografie ausmalen, nicht aber als die selbstständigen und komplex abwägenden Akteure, die sie sind.
Nota. - Es tut weh, aber es lässt sich nicht ändern: Links nennen sich nur noch Leute, denen es nicht zusteht, aber es macht ihnen keiner streitig, weil es Leute, denen es zustünde, nicht mehr gibt.
Links nannten sich und wurden genannt die Leute, die mehr oder minder aktivistisch an der Revolution arbeiteten, der bürgerlich-demokratischen zuerst, doch seit dem Juni 1848 der roten und sozialen. Und je entschiedener die auftraten, umso schmählicher wurde es, in guter Gesellschaft als links zu gelten. "Geht doch rüber in den Osten!" rief man den ostermar-schierenden Friedensfreunden in Adenauers Zeiten zu, dabei war denen alles Revolutionäre fremd; zumal den unterwandernden heimlichen KPD-Sympathisanten, die ihren Seelenfrieden in der reaktionären Spießeridylle des ersten Friedensstaats auf deutschem Boden gefunden hatten. Deutsche Sozialdemokraten waren von Herzen entrüstet, als links verunglimpft zu werden. Und sie waren's wirklich nicht, sie waren atlantischer, als Adenauer sich je entblödet hätte.
Als sie dann selber regierten, nannte Willy Brandt, der Vater der Hamburger Erlasse alias Be-rufsverbote, sich auf einmal links, und die inzwischen legale DKP ließ es durchgehen, weil er auf dem Weg war, ihren Friedensstaat anzuerkennen, und linker war sie selber nicht. Links war schon kein Politikum mehr, sondern ein Lifestyle, in dem sich eine Bekentnnisgemeinde zu-sammenfand. Ihr zusehnds härterer, zumindest korpulenterer Kern war jener Teil der Öffent-lichen Dienstes, der im Bildungs- und Kulturbetrieb sein Auskommen hatte und den autono-meren Randgruppen Zugänge zur Staatsknete vermitteln konnte. Denn wenn sie auch rituell Steine warfen - fürs eventuell Revolutionäre waren und sind sie bis heute viel zu saturiert.
Und je saturierter, umso zugänglicher den moralischen Erpressungen der noch Mindersatu-rierten. Solidartität heißt das dann, und korrekte Gesinnung muss sich daran messen lassen. Ihr Verhältnis zu Ordnung und Schweinesystem ist nicht subversiv, sondern zehrend. Die sind so revolutionär wie die Rettungsringe am Bauch von Robert Habeck.
JE
Dienstag, 24. November 2020
Kulturimperialismus? - Ein Blick von außen-
aus nzz.ch, 24.11.2020
Sie beobachtet in den USA und in Europa unter gebildeten jungen Leuten einen Überdruss an Wohl-stand und Freiheit. Und einen Selbsthass, den sie als Immigrantin nicht teilen kann. Ayaan Hirsi Ali hält die neuen akademischen Systemkritiker für Irrläufer – und erklärt im Gespräch mit René Scheu, warum die Eliten trotzdem mit ihnen paktieren.
Ayaan, lassen Sie uns gleich in medias res gehen, dahin, wo es weh tut. Sie sind schwarz, Sie sind eine Frau, Sie sind eine Feministin, Sie waren in Somalia Opfer einer echten patriarchalischen Gesellschaft. Warum werden Sie von den linksliberalen urbanen feministischen Eliten in den USA und anderswo trotzdem nicht umworben?
Ich denke, das liegt daran, dass ich deren Erwartungen zuverlässig enttäusche. Solche Enttäuschungen ist das mächtige linke Establishment in diesen konformistischen Zeiten kaum mehr gewohnt. Das macht sie ziemlich wütend.
Was haben Sie denn Böses gesagt?
Nichts, denn das liegt mir fern. Aber ich spiele ihr Spiel nicht mit. Ganz einfach: Ich weigere mich, das Opfer zu sein, das sie in mir sehen wollen. Würde ich es spielen, könnte ich alles bekommen, was ich will. Denn die akademischen Amerikaner sind geradezu besessen von den Themen Rasse und Sklaverei. Wenn ich sie daran erinnere, dass auch die Sklaverei eine Lieferkette kennt, hören sie weg und wechseln das Thema. Wo ich herkomme, wissen das alle: Auch Afrikaner versklaven Afrikaner, das war im 18. Jahrhundert so, als afrikanische Helfershelfer den Sklavenhändlern zuarbeiteten, und es ist heute so. Rassismus und Sklaverei zählen zum Schlimmsten, was die Menschen tun, seit es sie gibt, aber sie sind keine westliche Spezialität. Eine westliche Spezialität ist allerdings ein Leben in Freiheit.
Friedrich August von Hayek hat die Freiheit einmal mit der Luft für die Menschen verglichen: Man spürt sie nicht, wenn man sie hat. Man bemerkt sie erst, wenn man sie nicht mehr hat.
Ich sage freiheraus, was ich denke: Die westliche Kultur mit ihrer Entdeckung der Freiheit ist allen anderen Kulturen überlegen, in der Vergangenheit und auch in der Gegenwart. Sie hat es zustande gebracht, die Unterdrückung der Frau, den Feudalismus und das Stammesdenken zu überwinden. Sie hat gesellschaftliche Offenheit, politische Freiheit, technische Innovation und wirtschaftlichen Wohlstand geschaffen. Ich leugne nicht, dass andere Kulturen ebenfalls ihr Besonderes und Wertvolles haben – aber die Freiheit der westlichen Kultur ist für alle Menschen von unschätzbarem Wert. Das sage ich als gebürtige Somalierin. Und das hören die linksliberalen Eliten nicht gerne.
Das ist paradox, denn es ist genau diese Freiheit, die es ihnen erlaubt, die eigene Ordnung schlechtzureden und einen breiten Kulturrelativismus zu pflegen. Wer sich so unangreifbar weiss, hat gut reden.
Das stimmt. Und diese Eliten leiden an kognitiver Dissonanz. Sie haben ihr Narrativ, wonach die westliche Kultur bloss auf Unterdrückung, auf der Perpetuierung von Unterdrückern und Unterdrückten beruht. Und wenn dann plötzlich jemand aus einem echten Unrechtsstaat kommt, in dem Menschen systematisch unterdrückt werden, und ihnen sagt, dass sie falschlägen, wenn sie ihre eigene Kultur schlechtmachten und stattdessen fremde Kulturen idealisierten, nun ja, dann haben sie zwei Möglichkeiten. Entweder sie überdenken ihre Position. Oder sie diffamieren die Person, die solche unerhörten Dinge von sich gibt. Normalerweise tun diese Leute Letzteres – und machen die kognitive Dissonanz zum Dauerzustand.
Das tribale Denken greift allerdings auch in unseren Breiten um sich, und das war ja eigentlich die Pointe meiner Einstiegsfrage. Es wird in öffentlichen und zuweilen auch in privaten Diskussionen nicht mehr darauf geachtet, was jemand sagt, sondern bloss darauf, wer etwas sagt – wobei die Identität allein durch Gruppenzugehörigkeiten definiert wird. Als weisser heterosexueller Mann habe ich mittlerweile denkbar schlechte Karten – ich verkörpere das neue Klischee des Bösen par excellence.
Wir erleben durch einen Teil der Gesellschaft gerade die Dämonisierung des weissen Mannes. In jedem weissen Mann – so das hyperradikale linke Narrativ, das in den USA längst etabliert ist und in Europa auch immer weitere Kreise zieht – steckt ein Unterdrücker, ein Täter, ein Patriarch. Er vereinigt auf sich alles Geld und alle Macht der Welt. Was immer er sagt, steht deshalb unter Verdacht – er will damit bloss seine Machtstellung, seine Privilegien, seine Dominanz verschleiern oder rechtfertigen. Und ich frage mich tatsächlich, warum viele diesen Blödsinn einfach so hinnehmen. Wo bleibt der Widerstand?
Ein guter Punkt. Die meisten ziehen den Kopf ein. Doch indem man auch in kritischer Absicht ständig darüber schreibt, trägt man unfreiwillig zur Etablierung dieser Denkstereotype bei.
Das ist zu kurz gedacht. Denn dieses Narrativ wird auch stärker, wenn man es nicht entzaubert. Genau das ist es ja, was in den letzten Jahren geschah. Und es geht so, nach einer Art neo- oder vulgärmarxistischem Muster: Es gibt nur Unterdrücker und Unterdrückte, also Machtverhältnisse. Anders als im Marxismus ist es jedoch nicht die soziale Stellung, sondern die Gruppenzugehörigkeit, die darüber entscheidet, wo man in der Unterdrückungshierarchie steht. Es gibt keine Kommunikation zwischen den Kategorien und also auch keine Versöhnung, es gibt bloss den Kampf, und da sind alle Mittel erlaubt. Das sind keine Denkstereotype mehr, das ist längst zur echten Glaubenslehre geworden.
Hat sie einen Namen?
Nennen wir sie die Woke-Glaubenslehre: Je schwächer du angeblich bist, desto mehr Macht steht dir zu. Entweder du teilst diese Dogmen, und dann gehörst du dazu, zählst zu den Guten und Gerechten. Oder du weigerst dich, sie anzuerkennen, weil du von den Vorteilen einer individuellen Leistungs- und Kompetenzgesellschaft überzeugt bist, und gehörst zu den Abtrünnigen, die ihre Gnade verwirkt haben. Diese Religionslehre hat ihre Priester und Priesterinnen. Die wichtigste Priesterin in den USA heisst Alexandria Ocasio-Cortez – mit über zehn Millionen Followern auf Twitter.
Okay. Aber Hand aufs Herz – wer glaubt wirklich an diese Dogmatik? Das klingt nach einer sehr abgehobenen, weltfremden Lehre. Lassen sich der Mann oder die Frau von der Strasse davon überzeugen? Und glauben die Eliten ernsthaft daran?
Jetzt wird es interessant. Nehmen wir zuerst die Eliten. Es gibt die kulturellen Eliten, die auf ihren Bildungsbesitz achten, es gibt die wirtschaftlichen Eliten, die mehr auf ihren Profit schielen, und es gibt die politischen Eliten, die es auf ihre Macht abgesehen haben. Sie alle spielen das Spiel längst mit. Manche von ihnen fühlen sich schuldig, weil sie eben Geld, Bildung, Macht haben. Andere fühlen sich nicht schuldig, wollen sich aber nicht exponieren, sondern in Ruhe ihr Leben führen und ihren Besitz pflegen. Und nochmals andere fürchten sich vor der radikalen Rechten und sind im Prinzip für alles zu haben, was der Etikette nach aus der linken Ecke kommt. Deshalb schauen die Eliten zu, dulden die neue Glaubenslehre oder tragen sie pro forma sogar mit.
Das wäre dann reiner Opportunismus.
Natürlich. Und das gilt auch für den Mann oder die Frau von der Strasse. Wenn du unter harten Bedingungen bei Ben & Jerry’s Ice Cream arbeitest, während dein oberster Chef lauthals die gewaltbereite «Black Lives Matter»-Bewegung unterstützt, dann zuckst du innerlich zusammen. Du verspürst Wut. Aber am Ende schweigst auch du – weil du deinen Job nicht verlieren willst und eine Familie durchzubringen hast.
Wenn Sie recht haben, hiesse das, dass eine kleine Minderheit von Aktivisten alle anderen Bürger vor sich hertreibt.
So verhält es sich in der Tat. Sie schreien laut, sie sind sehr effektiv und höchst gefährlich. Sie finden Verbündete in den Eliten, die sich einen Nutzen von der neuen Glaubenslehre versprechen. Die setzen über alte Medien und soziale Netzwerke ganze Industrien, Firmen, Hochschulen und Parlamente moralisch unter Druck. Sie haben schon Lehrstühle und sitzen schon in Parlamenten. So hat sich ihr sprachliches Framing mittlerweile bis in den Alltag hinein durchgesetzt, alle reden die ganze Zeit von den Idealen von Ergebnisgleichheit, Inklusion und sozialer Gerechtigkeit. Und Leute wie Sie und ich, akademisch nicht unbeleckt, keine Profiteure des Systems, unabhängig, schütteln den Kopf. Aber gegenwärtig hört uns kaum jemand zu.
Sind Sie frustriert?
Nein. Ich bin im Reinen mit mir – und ich höre nicht auf zu sagen, was ich denke, und zu begründen, was ich sage. Und tief in meinem Innern bin ich überzeugt, dass diese ganze Woke-Glaubenslehre irgendwann so schnell verschwinden wird, wie sie gekommen ist. Sie ist wie Zuckerwatte: bunt, schrill, aber sie schmeckt zu süss, man kann nicht zu viel davon essen, weil einem sonst schlecht wird, und der intensive Geschmack vergeht im Nu.
Was macht Sie da so sicher?
Umschwünge gehen heutzutage schnell vonstatten, gleichsam über Nacht. Ich erinnere mich an die Partei der Arbeit, eine stolze sozialdemokratische Partei in den Niederlanden. Sie hat über hundert Jahre lang beachtliche Ergebnisse erzielt, des Öfteren den Ministerpräsidenten gestellt. In den Wahlen von 2017 sackte sie aber völlig ab – und dürfte sich von dieser Niederlage kaum mehr erholen. Ähnliches geschah mit der SPD in Deutschland und mit der Labour Party unter Jeremy Corbyn in Grossbritannien. Werden die Parteien zu Sekten, verlieren sie plötzlich den Rückhalt der meisten ihrer Wähler.
Sie reden von Glaubenslehre und Sekten. Das wirkt zunächst eher paradox – sind denn die Leute, die der Wokeness anhängen, nicht betont atheistisch unterwegs?
Doch, das sind sie. Die neue Glaubenslehre duldet keinen Gott über oder neben sich. Insofern ist sie keine Religion, sondern eher eine Form des aggressiven New Age, also ein Religionsersatz. Sie hat einen einseitigen Blick auf die Geschichte des Westens, die ihrer Meinung nach allein auf Rassismus, Ausbeutung und Kolonialismus beruht. Was Ihnen Ihre Eltern hoffentlich beigebracht haben – hart zu arbeiten, das Gesetz zu beachten, das Eigentum anderer zu respektieren –, all diese Tugenden gelten den neuen Jüngern nichts mehr. Sie nennen es «whiteness» und wollen es überwinden. Und zuletzt lehnen sie das jüdisch-christliche Erbe radikal ab – und machen die Traditionen schlecht.
Wenn ich Sie so reden höre, denke ich an Revolutionäre, an eine Art postmoderne Jakobiner. Ist das, was diese Leute antreibt, der Hass auf die eigene Kultur?
Zweifellos – an der Oberfläche. Der Selbsthass, die Selbstscham wird zur Schau getragen. Dahinter verbirgt sich aber eine eigenartige Form eines moralischen Überlegenheitsgefühls, nach der Logik: Wer sich erniedrigt, erhöht sich zugleich. Er liebt sich im Selbsthass. Er ist der moralische, erhabene, unfehlbare Mensch, der letztlich auf alle anderen herabsieht.
Sie sind muslimisch erzogen worden. Sind Sie denn selbst gläubig?
Nein. Ich bin nicht fromm. Ich habe die Religion meiner Eltern hinter mir gelassen. Aber ich unterschätze nicht das Potenzial, den Wert und die Funktion von Religion. Ich würde nie im Leben sagen, dass Religion nur etwas für die Dummen sei, wie viele Intellektuelle glauben.
Obama sprach in diesem Sinne, als er einmal über die Arbeiter sagte, sie würden sich mitunter «an Waffen oder Bibeln klammern», wenn es ihnen schlecht gehe. Die christliche Religion ist für Obama so etwas wie der Strohhalm der Verzweifelten – und viele, die sich zum Establishment zählen, denken so. Oder sie denken, der Glaube führe automatisch zu Intoleranz und Gewalt. Aber das ist eine sehr verkürzte Sicht der Dinge. Religion stiftet Gemeinschaft, bringt Leute zusammen, macht sie zu selbstbewussten Individuen, weil sie sich von Gott angesprochen, geliebt und getragen fühlen. Es war diese Dimension, auf die ich einmal neidisch war.Wie meinen Sie das?
Ich erinnere mich, wie ich meinem Vater, der in den USA und Italien studiert hatte, sagte: Schau dir die Frauen in christlichen Ländern an, sie sind frei zu tun, was immer sie wollen. Schau dir die wissenschaftlichen Errungenschaften an. Schau dir den Wohlstand und die Liberalität an. Und dann schau dir an, was die islamische Kultur erreicht hat. Schau, wie sie mit Frauen umgeht. Man hatte mir beigebracht, dass meine Kultur allen anderen überlegen sei. Aber das war empirisch falsch, und das liess mir keine Ruhe. Ich ertrug die kognitive Dissonanz nicht länger, und 1992 gelang es mir, nach Europa zu flüchten.
Es war für Sie das gelobte Land.
Ja, zu Beginn. Die Leute waren damals noch stolz auf ihr Gemeinwesen, auf ihre politische Kultur, die Marktwirtschaft, die Demokratie. Seither hat sich im mentalen Haushalt der Leute viel verändert, in Europa und den USA. Der Wohlstand ist weiter gestiegen, aber es ist, als hätte sich eine grosse spirituelle Leere ausgebreitet. Und nichts vermag diese Leere zu füllen. Schauen Sie – als ich fünfzehn, sechzehn Jahre alt war und es unserer Familie an allem fehlte, fragte ich mich: Warum tut Gott uns das an, warum lässt er uns leiden? Was ist der Sinn meines Lebens, warum wurde ich geboren? Die Leute im Westen sind materiell saturiert, die meisten haben zu viel Geld, zu viel Unterhaltung, zu viel Technologie, zu viel Freizeitangebote. Aber sie stellen sich irgendwann immer noch dieselbe Frage – was soll das alles? Worum geht es eigentlich? Sie spüren die Leere weiterhin, und das macht sie fast wahnsinnig.
Verstehe ich Sie richtig – Sie sagen, dass die meisten im Westen nicht aus Not, sondern aus Überdruss zu Systemkritikern werden?
Bestimmt. Es geht ihnen zu gut, nicht zu wenig gut. Sie leiden nicht an Mangel, sondern an Überfluss. Die Woke-Leute sind letztlich Nihilisten, die diese Leere spüren und sagen: Es geht um nichts, es gibt keinen Sinn des Lebens, lasst uns das ganze System niederreissen. Aber natürlich gibt es auch die, die an den Lippen von Autokraten, Tyrannen und Imamen hängen, die ihnen versprechen, ihrem Leben einen Sinn zu geben. Der jüngst verstorbene Schriftsteller und Philosoph Roger Scruton, ein treuer Freund, der mir sehr fehlt, pflegte zu sagen: Wenn wir unsere innere Leere nicht selbst füllen, dann werden sie andere füllen.
Wie füllen Sie Ihre Leere?
Konservative haben es bestimmt leichter als Progressive, auch wenn sie wie ich nicht an Gott glauben. Ich liebe meine Familie, für die ich sehr dankbar bin. Und ich pflege Umgangsformen und Traditionen, ich lebe wie eine funktionale Christin: nicht im eigentlichen Sinne fromm, aber aufgehoben in einer Alltagskultur.
Sie waren einst Muslimin, Sie wurden zur Atheistin – und heute sind Sie eine Kulturchristin.
Ganz konkret: Ich glaube, dass Sie, René, ein guter Mensch sind und dieses Interview mit den besten Absichten führen. Und Sie glauben, dass ich Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen Red und Antwort stehe. Ich traue Ihnen, Sie trauen mir, wir haben eine implizite Vereinbarung. Wir teilen unsere Gedanken für diese Zeit, wir behandeln uns mit Respekt und Anstand, wir teilen bestimmt manche Ansichten, in vielen Fragen sind wir uns jedoch nicht einig, aber wir lernen voneinander – das ist es, was dem Leben Freude und Fülle gibt.
Ayaan Hirsi Ali
ist 1969 in Mogadiscio, Somalia, geboren. 1992 reiste sie über
Deutschland in die Niederlande ein. Sie studierte Politikwissenschaften,
1997 wurde ihr die niederländische Staatsbürgerschaft verliehen. Im
Jahr 2003 wurde sie für die liberal-konservative Volkspartei für
Freiheit und Demokratie (VVD) ins niederländische Parlament gewählt.
Seit 2006 lebt sie in den USA, ist seit 2013 amerikanische
Staatsbürgerin und arbeitet gegenwärtig als Research Fellow an der
Hoover Institution in Stanford. Ayaan Hirsi Ali ist mit dem Historiker
Niall Ferguson verheiratet. Zu ihren jüngeren Publikationen zählen
«Reformiert euch! Warum der Islam sich ändern muss» (Penguin-Verlag,
2016) und «Ich klage an: Für die Freiheit der muslimischen Frauen»
(Piper-Verlag, 2010).
Noch eine Verschwörungstheorie.
 research-in-Germany
research-in-Germany In meiner Nachbarschaft wohnt ein Verrückter, der bringt eine ganz eigenwillige Verschwö-rungstheorie in Umlauf: Melania Trump und Jared Kushner hätten ihrem MadDonald den Floh ins Ohr gesetzt, er sei durch Manipulation um den Wahlsieg geprellt worden und müsse nun vor Gericht die Wahrheit ertrotzen.
Sie kennen ihren Pappenheimer und sahen mit Sorge voraus, dass er bedenkenlos seine An-hänger aufputschen und das Land in einen Bürgerkrieg treiben würde. Stattdessen lässt er nun seine Anwälte unter dem Hanswurst Giuliani einen tagtäglichen Kleinkrieg vor einem paar Dutzend Gerichten vortanzen und seine Anhängerschaft... abwarten. Und von einer Gerichts-klatsche zur nächsten lassen sie ein bisschen Dampf ab. Nun, wo auch Michigan gefallen ist, ist die Luft raus. Jetzt kann er getrost klein beigeben und... die Erwartungen auf die Senatswahlen in Georgia verschieben. Summa summarum eine fast normale Amtsübergabe.
Wie gesagt - der Nachbar ist nicht ganz bei Trost. Doch das dortige Irrenhaus kann einen auf die abwegigsten Ideen bringen.
Montag, 23. November 2020
Die Geschichte der Indianer Nordamerikas.

aus spektrum.de, 23.11.2020 lpcinitiative
Geschichte der Indianer
Von
der ersten Besiedelung Amerikas über die Kolonialzeit bis heute: Eine
neue kompakte Gesamtdarstellung gibt Einblick in die vielschichtige
Vergangenheit der indigenen Bevölkerung Nordamerikas – fernab von
Klischees, wissenschaftlich fundiert und hochaktuell.
von Sebastian Hollstein
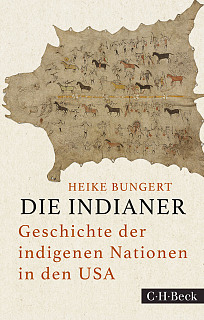
Es
fällt schwer, die Geschichte der Indianer nicht als eine Folge von
Betrug, Diskriminierung und gewaltsamer Vertreibung durch die
Euroamerikaner zu betrachten – auch nach der Lektüre dieser aktuellen,
informationsreichen und komprimierten Gesamtdarstellung. In mehr als der
Hälfte der 13 Kapitel spielen Auseinandersetzungen zwischen Indigenen
und den aus Europa stammenden Einwanderern und ihren
Nachfolgegenerationen – in der Regel mit negativen Konsequenzen für die
Indianer – eine gewichtige Rolle. Trotzdem gelingt Heike Bungert durch
ihre sachliche und wissenschaftliche Herangehensweise eine
vielschichtige Betrachtung.
Die
Historikerin von der Universität Münster und Expertin für
nordamerikanische Geschichte macht es sich zur Aufgabe, mit den
Indianern »keine passiven Opfer der Euroamerikaner oder Objekte«
darzustellen, sondern ihre Geschichte »als Interaktion verschiedener
indianischer und euroamerikanischer Kulturen mit daraus resultierender
Transformation aller Beteiligten« zu beschreiben.
Das könnte Sie auch interessieren: Spektrum Kompakt: Maya, Inka, Azteken – Die Hochkulturen Lateinamerikas
Kenntnisreich und souverän leitet die Autorin durch das enge Geflecht hunderter indianischer Völker und Gruppen. Zwei Karten im Anhang des Buchs helfen bei der Zuordnung der Siedlungsgebiete. Sie verzichtet auf Legenden und Pathos und ordnet prominente Indianer – wie Sitting Bull, Crazy Horse oder Pocahontas – in die historischen Gesamtzusammenhänge ein, anstatt sie besonders herauszuheben.
Bungert
schreibt aus einer neutralen Perspektive heraus und zeigt, dass die
ersten Zusammentreffen mit den Europäern nicht nur feindselig waren.
Beide Seiten versuchten, Vorteile aus der Begegnung zu ziehen. So
gewannen die Franzosen die Indigenen sowohl als wichtige Handelspartner,
etwa für Pelze, als auch als Verbündete gegen die Engländer. Dort, wo
sich nicht zu viele Europäer auf einmal niederließen, kam es durchaus
zum Kennenlernen, Austausch der Kulturen und zu Kooperation.
»Euroamerikaner und Indianer, aber auch indigene Gruppen untereinander
übernahmen kulturelle Praktiken ihrer Handelspartner, um Verständigung
und Überleben zu gewährleisten. So akzeptierten Europäer tagelange
Zusammenkünfte mit Reden, Gebeten, Tänzen und gemeinsamem Rauchen der
Kalumet-Pfeife und Austausch von Geschenken. Indianische Gruppen passten
Europäer in ihr Verwandtschaftssystem ein und bezeichneten den
französischen Gouverneur beispielsweise als ›Vater‹.«
Häufig
suchten Indianergruppen auf diese Weise Verbündete gegen ansässige
Konkurrenten. Das zeitweilige Einvernehmen, das vor allem auf die
zahlenmäßige Überlegenheit der Indigenen zurückzuführen ist, hatte
mitunter Auswirkungen auf ihre Lebensgewohnheiten. So übernahmen
Indianer importierte Gegenstände und Praktiken oder zogen in die Nähe
euroamerikanischer Siedlungen. Die Weißen dagegen verließen sich etwa
auf die Ortskenntnis und Versorgungsleistungen ihrer Nachbarn.
Ein friedliches Zusammenleben war häufig allerdings nur von
kurzer Dauer. Bereits früh drängten insbesondere die Engländer einzelne
indigene Gruppen weiter nach Westen. Gleichzeitig beteiligten sich
Indianer auf unterschiedlichen Seiten an euroamerikanisch initiierten
Konflikten, wie dem Krieg zwischen Engländern und Franzosen oder dem
amerikanischen Unabhängigkeitskrieg, und traten nicht als indigene
Einheit in Erscheinung.
Zeitweilige
Bündnisse mit den Eindringlingen konnte ihre Vertreibung jedoch nicht
verhindern. Bungert schildert detailliert, wie die Indianer über die
folgenden Jahrhunderte hinweg meist vergeblich versuchten, durch
Diplomatie, Gewalt sowie durch Anpassung ihrer Lebensweise, die eigenen
Siedlungsgebiete und Lebensweisen zu bewahren, und wie sie unter der
aufkommenden Entwurzelung litten. »Die psychologischen Folgen für
Gruppen, die wie die Winnebagos siebenmal in 30 Jahren migrieren
mussten, lassen sich kaum abschätzen«, schreibt die Autorin. Ende des
19. Jahrhunderts lebten nahezu alle Angehörigen der indigenen
Bevölkerung in Reservaten.
Besonders informativ – da seltener behandelt – sind die beiden Abschnitte, die den Zeitraum zwischen der Ankunft der Weißen und dem Ende der Indianerkriege 1890 einrahmen. Ab etwa 14 000 v. Chr. gelangten die indianischen Vorfahren vermutlich in mehreren Wellen aus Nordsibirien und dem nordöstlichen Teil Asiens über eine Landzunge nach Nordamerika. Skelettfunde wie die »Buhl Woman« aus Idaho und der »Kennewick Man« aus dem Staat Washington unterstützen diese These.
Erste landwirtschaftlich geprägte Kulturen wie die
Hohokam, die zwischen dem 6. und 14. Jahrhundert im Südwesten Mais,
Kürbisse und Baumwolle anbauten und dabei viel Aufwand für die
Bewässerung ihrer Felder betrieben, siedelten sesshaft in größeren
Dörfern. Mississippi-Kulturen im Südosten brachten sogar so genannte
Chiefdoms hervor, wie Cahokia in der Nähe des heutigen St. Louis. In den
stadtähnlichen Verwaltungseinheiten sowie wirtschaftlichen und
religiösen Zentren lebten tausende Menschen zusammen.
In einem Kapitel gibt Bungert zudem spannende Einblicke in
die vielfältigen Gesellschaftsstrukturen und die religiösen
Vorstellungen der Indigenen kurz vor der Ankunft der Europäer. So
verweist sie beispielsweise auf die weit verbreitete Matrilinearität,
also die Ausrichtung der Abstammung einer Familie auf die Ehefrau.
In den abschließenden Kapiteln beschreibt die Autorin ein langes Jahrhundert bis in die Gegenwart, in dem sich die Indianer gegen Diskriminierung, assimilatorische Initiativen und kulturelle Auslöschung zur Wehr setzten und unter anderem durch panindianische Bürgerrechtsbewegungen Souveränität und einen Platz in der amerikanischen Gesellschaft für ihre Nationen erkämpften. Ihre Lebensumstände sind allerdings bis heute von einer schwierigen Beziehung zu den USA und damit einhergehender Benachteiligung geprägt – Armut, Arbeitslosigkeit und Unterversorgung kennzeichnen das Leben in vielen Reservaten.
Nota. - So wenig wie die Germanen gegenüber den Römern, verstanden sich die indianischen Stämme gegenüber den eindringenden Europäern als eine Einheit. Folglich hatten sie keinen Namen für sich und müssen bis heute mit der Bezeichnung leben, die jene ihnen gaben. So hat die Autorin als Historikerin guten Grund, von Indianern zu sprechen und nicht von Native Americans - wie People Without Color sie inzwischen umzutaufen belieben.
JE

